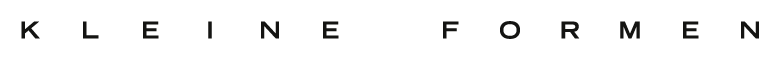Forschungsidee
Warum kleine Formen?
Die Klage über die ,Flut‘ von Nachrichten, Informationen und Novitäten, die zur Kenntnis genommen werden wollen, ist spätestens seit der Frühen Neuzeit notorisch. Gegenwärtig gewinnt sie jedoch im Sog von medialen Mobilitätsschüben und digitalen Vernetzungsmöglichkeiten an Aktualität. In dem Maß, wie soziale Aufmerksamkeitsressourcen knapper und Interessenlagen von Individuen volatiler werden, wächst der Druck, der Überfülle des Wissbaren mit einer effizienten Organisation von Merkwelten zu begegnen und neue Kreativitätsspielräume ebenso rasch zu erkennen wie versiert zu nutzen.
Das macht kleine Formen des Schreibens und Notierens attraktiv, die bei der Buchführung über Beobachtungen und Ideen, bei der Vermittlung von Kenntnissen und bei der Lenkung von Neugierden helfen und zugleich den Umgang mit beschränkten Zeit- und Platzvorgaben erleichtern. Textsorten wie Skizzen, Abstracts, Notizen, Protokolle, Exzerpte, Essays, Artikel und Glossen können die Vorzüge des Kompakten, Kondensierten, schnell zu Überschauenden geltend machen, aber auch das Vorläufige, Flüchtige und Ergänzungsbedürftige des Festgehaltenen ausstellen und sich auf diese Weise als verlässliche Garanten von Verständigungsroutinen wie als Störer, als Quelle produktiver Irritationen empfehlen. Trotz der elementaren Bedeutung, die sie damit gerade für die Gebrauchskontexte von Forschung und Unterricht, Kunst und Medienöffentlichkeit besitzen, sind Genese und Evolution ihres Formenspektrums bislang jedoch nur punktuell erforscht.
Das Graduiertenkolleg wird die Literatur- und Wissensgeschichte solcher Formen im historischen Aufriss von der Antike bis zur Gegenwart untersuchen. Es richtet den systematischen Fokus auf die Praxisfelder von Literatur, Wissenschaft und Populärkultur und erforscht, welche Kleinformen des Schreibens und Darstellens sich innerhalb dieser Felder etablieren, wie mit ihrer Hilfe hier Verständigungsprozesse gesteuert, reflektiert, kritisiert und medienspezifisch kanalisiert werden. Des Weiteren gilt sein Interesse den Austauschdynamiken kleiner Formenzwischen diesen Feldern: den Wechselbeziehungen, die durch deren Trennungsgeschichte ermöglicht, aber auch blockiert werden.
Am Kolleg beteiligt sind die Fächer Anglistik, Germanistik, Klassische Philologie, Romanistik, Slavistik, Wissenschaftsgeschichte, Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft und Praktische Theologie.
Begriff „kleine Form“
Der Begriff „kleine Form“ ist elastisch und unterbestimmt, in der Literaturwissenschaft aber seit langem eingeführt. Begriffsgeschichtlich geht die Bezeichnung auf das ausgehende 19. Jahrhundert zurück. Damals bezog sie sich in erster Linie auf die mannigfaltigen Spielarten der Kurzprosa, die sich speziell im Feuilletonteil der Presse – in der optisch abgeteilten Randzone im unteren Drittel der Zeitungsseite – entwickelten, wobei ihr Duktus skizzenhaft, impressionistisch und flüchtig sein konnte, in anderen Fällen lyrisch verdichtet, gedanklich konzentriert und gleichnishaft.
Inzwischen wird der Begriff weiter gefasst und sowohl für Kürzestformen wie das Sprichwort und den Witz als auch für kleine Erzählgattungen – die Kurzgeschichte beispielsweise – verwendet. So überschneidet sich das Feld der „kleinen Formen“ einerseits mit dem der „einfachen Formen“, das André Jolles absteckte. Andererseits fallen unter diese Rubrik didaktische Gebrauchsformen wie das Exemplum oder die Fabel, die für den antiken Rhetorikunterricht genauso unentbehrlich waren wie in der christlichen Homiletik für die Moralpredigt oder später, im 18. Jahrhundert, für die Vernunfterziehung der Aufklärer. Derselben Tradition rhetorischer Topik entstammen die knappen Reflexionsformen mit Lehrsatz-, Sentenz- oder Maximencharakter, die anfangs als instruktive dicta gesammelt wurden, bevor sich die Kollekte auf Gedanken, Einfälle und Ideen aller Art ausdehnte, die durch die regelmäßige und minutiöse Privatbuchhaltung Eingang in Notiz- und Tagebücher fanden. Infolge dieser Praxis veränderten im 17. Jahrhundert nicht nur hergebrachte, aus der antiken Medizin hervorgegangene Textsorten wie der Aphorismus ihre Form. Sie führte auch zum Aufschwung neuer Genres wie des Essays, deren formale Offenheit später gerade auf die Feuilletonprosa ausstrahlte.
Als unbestritten gilt, dass sich das Spektrum dieser kleinen Formen vor allem seit der Neuzeit beträchtlich ausdifferenziert hat und in überwiegendem Maß von Spielarten der Kurzprosa geprägt wird, die auf Modernität Wert legen, ohne ihre Herkunft aus älteren Traditionen zu leugnen. Auch herrscht Konsens darüber, dass sich die Disparatheit des Felds kaum durch die rigide Definition von Ausschlusskriterien vermindern lässt, mit der die hier interessierenden Formaspekte etwa auf Fragen der Gattung – erst recht nicht der literarischen – verengt werden könnten. Gattungen setzen zwar Formkonventionen voraus, doch verfestigt sich nicht jede Form zu einer Gattung, und speziell an den kleinen Formen, denen das Interesse des Kollegs gilt, lässt sich beobachten, dass sie unterschiedliche Genres durchwandern. Diese generische Beweglichkeit hängt mit dem Umstand zusammen, dass die ‚Kleinheit‘ der Formen von vornherein nur relational bestimmt werden kann: in Wechselbeziehung zu größeren Komplexen. Kleinformen entstehen als Abbreviaturen, durch Selektion und Verdichtung; sie stimulieren durch ihre Partikularität aber gleichzeitig Ergänzungen, können rekombiniert und amplifiziert werden und sich als Formen auf diesem Weg ganz unterschiedlich zur Geltung bringen.
Dem trägt der Ansatz des Kollegs Rechnung, indem er von einer terminologischen Zwangsvereinheitlichung absieht und den Akzent auf praxeologische Gesichtspunkte verschiebt, indem er die Kleinformen als Produkt und Motor von Kommunikations- und Zirkulationsprozessen ins Zentrum rückt. Anstelle von fixen Merkmalen werden damit die Dynamiken fokussiert, die sie in ihren jeweiligen Gebrauchszusammenhängen entfalten.
Forschungsansatz: Ästhetik und Pragmatik kleiner Formen
Ziel des Kollegs ist die Klärung der Funktionen und Leistungen, die diese Formen insbesondere in epistemischen, schulischen, bildungshistorischen, publizistischen und literarischen Praxiskontexten erbringen. Dabei ist die These leitend, dass die Kleinformen am Erwerb von Kenntnissen, an der Weitergabe von Erfahrungen und der Lenkung von Neugierden aktiv beteiligt sind und zugleich durch die entsprechenden Prozeduren sowie durch die in sie involvierten Medien selbst geformt werden.
Bei der extensiven Durchdringung des Forschungsgebiets knüpfen wir an Formbegriffe an, die wir in der bisherigen Kollegarbeit einerseits in produktiver Auseinandersetzung mit aktuellen Theorieangeboten geschärft und andererseits in konsequenter Verfolgung eines praxeologischen Ansatzes präzisiert haben. So betrachten wir die ,Kleinheit‘ nicht als substantielle Eigenschaft der untersuchten Formen, sondern als aktuelle Gegebenheit und temporäre Disposition, die potenzielle Veränderungen – Ergänzungen, Rekombinationen, Ausfaltungen – nicht ausschließt, sondern dazu anregt. Vorausgesetzt ist darin zugleich ein dynamisches Formverständnis, das neben ökonomischen Bedürfnissen des Zeit- und Platzsparens auch ökologische Faktoren der jeweiligen Text- und Medienumgebung als situative Variablen einkalkuliert. Vorgefundene Kleinformen können, wenn sie diesen Umwelten angepasst werden, Vorzüge oder Widerständigkeiten entwickeln, die in vorigen Gebrauchskontexten nicht zutage traten, dabei außerdem Verknüpfungen mit anderen Formen eingehen.
Dynamisch ist der hier bevorzugte Formbegriff auch in dem Sinn, dass er – anders als die hergebrachten Gattungsbegriffe in der Terminologie der Literaturwissenschaft – das Autonomwerden und -bleiben von Formen lediglich als Möglichkeit behandelt, aber für ihre Regeneration als Formen nicht zur zwingenden Notwendigkeit erklärt. Schon die bisher in den Einzelstudien der Kollegiat·inn·en beleuchteten Kleinformen – Notizen, Exzerpte, Aufsätze, Listen, Telegrammbotschaften, Fallgeschichten, Gerichtsreportagen, Feuilletons, Fortsetzungsepisoden und andere mehr – zeichnen sich bei aller typologischen Verschiedenheit dadurch aus, dass sie sowohl als kleine Formen von Texten wie auch als kleine Formen in größeren Gesamtgebilden, als partikulares Element von Sammelwerken auftreten und für die jeweiligen Nutzer·innen gerade aufgrund der so gewonnenen Beweglichkeit attraktiv sind.
Im Blick auf die drei Praxisfelder von Literatur, Wissenschaft und Populärkultur lauten die übergeordneten Forschungsfragen des Kollegs:
- Welche Kleinformen des Erzählens, Räsonierens und Darstellens konnten und können sich innerhalb dieser Felder etablieren, und wie werden mit ihrer Hilfe Verständigungsprozesse gesteuert, reflektiert, kritisiert und medienspezifisch kanalisiert?
- Welche Austauschbeziehungen lassen sich zwischen den Feldern beobachten? Welche Wechselbeziehungen ergeben sich im Zuge ihrer Trennungsgeschichte, welche werden durch sie blockiert?
- Welche Parameter bestimmen die Interdependenz von kleinen Formen, Gebrauchskontexten und Wissensproduktion?
Neuakzentuierungen der zweiten Förderphase
1. Formen und Formate
Während in unseren bisherigen Verständigungen die Ökonomie kleiner Formen und deren damit verbundene ästhetische Eigenarten im Vordergrund standen, sollen künftig vermehrt die ökologischen Umgebungen in den Fokus rücken, in denen kleine Formen kultiviert werden. Insbesondere wird unsere Aufmerksamkeit den Wechselbeziehungen von Formen und Formaten gelten: der ,In-Formation‘ von Kleinformen durch materielle Gegebenheiten ihrer jeweiligen Träger- und Verbreitungsmedien. Über die Problematisierung von Formatfragen ergeben sich produktive Anknüpfungsmöglichkeiten an aktuelle Diskussionen in den internationalen Medienwissenschaften wie in der buch- und pressegeschichtlichen Forschung, die unseren praxeologischen Ansatz mit weiterführenden Erwägungen zur Materialität der Form ergänzen können.
Lange war der Term des „Formats“ als Fachbegriff der Buchdruckbranche gebräuchlich und auf den Zuschnitt der verwendeten Papiermaße bezogen. Später haben Kunsthistoriker wie Jacob Burkhardt über Hoch- und Querformate, runde, ovale und rechteckige Bilder und deren Eignung für Motive sowie ihre Prädestination für besondere Schauräume nachgedacht. Zu den analogen visuellen Medien sind inzwischen zahlreiche digitale Medien hinzugekommen, deren Formatstrukturen zugleich als materiale Spuren der medienindustriellen Umwelten lesbar sind, die sie umgeben. Die jüngsten Ausarbeitungen des Formatbegriffs tragen dem Rechnung.
In buch- und zeitungsgeschichtlichen Forschungen finden solche Studien ihr Pendant in Untersuchungen, die Produktion und Vertrieb von Texten mit Rücksicht auf die Vorformatierungen des beschriebenen und bedruckten Materials neu reflektieren. Das hat losen Blättern, Heften, Faszikeln und Autographen, die als Kontaktreliquien in zerschnittener Form die Runde unter den Verehrer·inne·n toter Dichter·innen zirkulieren, eine erhöhte Aufmerksamkeit beschert. Auch in der Buchform selbst kommen höchst unterschiedliche Teile zusammen – Verzeichnisse, Kapitel, Titel, Register –, die je eigene Vorgeschichten haben und mit dem ,Ganzen‘ des jeweiligen Bands nur partiell feste Koppelungen eingehen. (s. Forschungsschwerpunkte 1 und 2)
2. Verbindungen und Übergänge zwischen Prosa und Poesie
Über die Proporzverhältnisse von Papier- und Bildschirmgrößen sowie die nötigen Kompressionen von Datenmengen, mit denen Medienformate der Form von Aufzeichnungen von außen Schranken auferlegen, werden quantitative Faktoren relevant, die bislang für das Gros der Formbegriffe mit literaturwissenschaftlichem Kredit eine nachgeordnete Rolle spielten. Auch einschlägige Studien zur kleinen Prosa betonen stets, dass die nähere Charakterisierung der Kleinheit nicht auf quantitative Kriterien der Knappheit fixiert bleiben kann, sondern qualitative Gesichtspunkte – Konzentration, Verdichtung, Formalität, Aperçuhaftigkeit, Flüchtigkeit etc. – mitberücksichtigen muss.
Das Anführen von Zahlengrößen als Bestimmungskriterium von Formen lag, wenigstens im Bereich der Literatur, lange Zeit nur auf dem Feld der Lyrik nahe, wo schon das Wort „rîm“ – als altnordische Wurzel des Reims sowie des angelsächsischen rhyme, das gleichzeitig den ganzen (Reim-)Vers bezeichnet – mit dem Zählen und Reihenbilden verbunden ist. Gedichtformen wie das Sonett oder das Haiku lassen sich mit ihren festgelegten Vers- bzw. Morenzahlen geradezu als Formeln anschreiben und verdanken diesem leicht universalisierbaren poetischen Algorithmus auch ihre globale Verbreitung. Im Gegensatz zu diesen Paradebeispielen poetischer Kurzformen, deren Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht, beziehen moderne Dichter·innen, allen voran die Vertreter·innen der Avantgarde, ihre Vorbilder für Experimente mit der Sprachverknappung aus den Novitäten der zeitgenössischen Medienöffentlichkeit – den Schlagzeilen der Presse, den Slogans der Reklame, den Worteinsparungen von Telegrammen – und registrieren dort zugleich, wie durch das Ausreizen der Materialität von Zeichen im Design der Typographie die „poetische Funktion“ der Sprache (Roman Jakobson) außerhalb der Poesie massiv an visueller Dominanz gewinnt.
Mit der Verbreitung von mobilen Telefonen und Messenger-Apps, die den schnellen Austausch von Nachrichten und Bildern durch arbiträre Zeichenlimits antreiben, sind solche contraintes der Sprachverknappung angesichts umkämpfter Zeit- und Aufmerksamkeitsressourcen in die Alltagskommunikationen von jedermann eingewandert. Darüber ist der öffentliche Schriftverkehr informeller, formloser, in jeder Hinsicht hemmungsloser geworden. Das multimedial einsetzbare Smartphone senkt nicht nur die Schwellen zwischen Poesie und Prosa, sondern auch zwischen Sprechen und Schreiben, Lesen und Hören, Sagen und Zeigen. Es verwandelt Botschaften, die dank seiner Hilfe sofort auf einem Forum erscheinen, durch den schieren Versand in performative Sprechakte und animiert die Schreiber·innen, den Auftritt ihrer Worte und sich selbst gleich mit zu inszenieren.
Hinter der Kreativität von Laien bei der Verquickung von Alltagskommunikation, Entertainment und Selbstvermarktung steht die Kreativität von Künstler·inne·n nicht zurück. Speziell in der Erzählliteratur Nord- und Südamerikas hat sich ein Universum von Kleinstfiktionen aufgetan, in dem Autor·inn·en sich mit engen Zeichenlimits wechselseitig unterbieten. Genauso gut floriert die Poesie. Auf Poetry Slams, bei denen Autor·inn·en von Poesie- und Prosatexten im Wettbewerb demselben Zeitlimit unterliegen, hat die Stimme dank der Verstärkung durch Mikrofone einen Großauftritt. Auf den Social Media-Kanälen wiederum zirkulieren zarte Verse, die die Kreationen der Poetry Slammer noch an Schlichtheit überbieten und Fangemeinden in Millionengröße ansprechen. Als „einfache Formen“ kommen damit nicht nur unverwüstliche Residuen des Archaischen in Betracht, sondern ebenso sehr jüngere Formen, die mit absichtsvollen Vereinfachungen operieren und sich damit prononciert von Traditionen abwenden oder Anti-Akademismus zelebrieren und damit Positionen der „Post-Kritik“ (Rita Felski) Auftrieb geben. (s. Forschungsschwerpunkte 2, 3 und 4)
3. Kleine Formen als Akteure in Kollektiven
Der immense Erfolg, den die Lyrik derzeit in der Popkultur erntet, erklärt sich auch über die hohe soziale Energie, die ihr Zirkulieren freisetzt. Durch geteilte Passionen entstehen Fangemeinden, die ihre Verbundenheit bei Lesungen und Slams zugleich in intensiver körperlicher Kopräsenz und affektiver Resonanz erfahren. Über Internet-Plattformen, die sich ihren Usern als soziale Medien andienen und Kooperativität beim Aufbau multipler Weltbeziehungen verheißen, können diese Gemeinden sich im virtuellen Raum vergrößern und Leute, die einander vorher nie begegnet sind, in Interaktionen treten lassen, die über das gemeinsame Partizipieren an Posts hinausreichen.
Während es für Gemeinden herkömmlichen Typs dabei wesentlich ist, dass sie sich als stabile Sozialverbände mit geteilter lokaler oder kultureller Identität, auch mit gemeinsamen Zielen und Werten definieren – beispielhaft sei auf Religionsgemeinschaften oder die Scientific Community verwiesen –, sind die sozialen Formationen, die sich mit der Unterstützung digitaler Vernetzungstechniken bilden, disparater und nur partiell mit traditionellen Kategorien wie „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ zu fassen. In Soziologie und Kulturtheorie der letzten Jahre haben insbesondere solche Kollektive Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die sich durch Heterogenität auszeichnen und aus einer „Gesellschaft der Singularitäten“ (Andreas Reckwitz) hervorgehen, dennoch aber als wirkmächtige Handlungseinheit auftreten können, auch wenn sie spontan entstanden sind und sich rasch wieder auflösen. Als frühe Vorläufer solcher Kollektive lassen sich soziale Bewegungen ansehen, die auf Straßen und Plätzen aufmarschieren und zur Mobilisierung der Massen sowohl rhythmisch markante Lieder als auch skandierte Slogans einsetzen.
Kleine Formen werden hier zu Medien einer politischen Streitkultur, die den institutionell gehegten Raum verlässt, um Macht-Rhetoriken kritisch zu verhören und ein „Unvernehmen“ (Jacques Rancière) zu artikulieren, das sich mit Postulaten einer Transformation des öffentlichen Rede- und Handlungsraums verquickt. Damit fällt ein zusätzlicher Lichtkegel auf das performative Potenzial kleiner Formen: auf ihre Bedeutung für die Bildung sozialer Formationen in der analogen und der digitalen Welt und auf die Agency, die sie entfalten, wenn sie zum Zweck der Gemeinschaftsbildung oder der Polarisierung in Umlauf gebracht und massenhaft ,geteilt‘ werden. (s. Forschungsschwerpunkte 1 und 3)
Forschungsschwerpunkte
Gebrauchsroutinen – Lehren, Lernen und Forschen in kleinen Formen
Untersucht werden die vielfältigen Dienstleistungen, die kleine Formen des Notierens und Erläuterns in der Unterrichts- und Erziehungspraxis sowie für den Bildungsbedarf erbringen, aber auch für Zwecke der Forschung, bei Invention und Improvisation, schließlich bei der Wissensverwaltung. Hier hat die griechische und römische Rhetorik Maßstäbe mit kultureller Langzeitwirkung gesetzt. Um die Kunst des guten Sagens zu professionalisieren, lehrte sie nicht nur, wie man Stilmittel auf Redeanlässe abstimmte, sondern auch die Vorratshaltung von Geschichten und Sentenzen einübte, so dass diese bei der Überzeugungsarbeit wiederverwertet werden konnten. Durch den Rückgriff auf Gesagtes, anderswo Berichtetes und nötigenfalls auch auf Erdichtetes sollte sich der Begründungsaufwand von Urteilen und Entscheidungen im öffentlichen Parteienstreit minimieren lassen.
In den bisherigen Untersuchungen des Kollegs hat sich dabei bestätigt, dass die rhetorischen Techniken gerade für die Ausdifferenzierung der Kleinprosa als wesentlicher Motor von Innovationen fungierten. In welcher Weise tradierte Wissensbestände in diesem Prozess sowohl bewahrt als auch aufgelöst wurden und inwiefern aus den neu entstandenen Formen neue Regeln, neue rituelle Regelmäßigkeiten im Kommunikations- und Kooperationsverhalten ganzer Gruppen erwuchsen, bleibt dennoch weiter zu durchdringen. Im Rahmen der bislang im Fokus stehenden Themen- und Fragekomplexe bieten sich dafür die folgenden Vertiefungen an.
Kleinformen als „little tools of knowledge“ I: Didaktische und epistemologische Funktionen
Lehren erteilen/Lernen lehren. Für die klassische Rhetorik war die Didaxe – sowohl im Blick auf die Vermittlung der eigenen Techniken als auch auf das Erteilen von Lektionen in Moral und Lebensklugheit beim Reden – eine Frage des versiert genutzten Geschichtswissens. Als Lehrmeisterin des Lebens erhielt die Geschichte (historia) vor der Dichtung (fabula) lange Zeit vor allem deswegen den Vorzug, weil sie ein Archiv verbürgter Präzedenzfälle bereithielt. Nach hergebrachter Auffassung hatten solche Exempel eine höhere Überzeugungskraft als fiktive Erzählungen.
Vor vielfältigeren Herausforderungen als politische Redner und akademische Lehrer standen die Verkündiger des Gottesworts. Die Heilige Schrift enthält neben der Offenbarung eines wundersamen, innerweltlich sich vollziehenden Heilsgeschehens auch die frohe Botschaft eines Lebens nach dem Tod, von der die Welt erfahren soll. Bischöfe wie Ambrosius von Mailand erfüllten im Italien der Spätantike diese Aufgabe mit höchster rhetorischer und philosophischer Brillanz und konnten damit anspruchsvolle Intellektuelle wie Augustinus für das Christentum gewinnen. Später taten Kirchenmänner gut daran, sich bei ihren Moralpredigten auf ein diverseres Publikum einzustellen, in dem Menschen ohne jede Latein- und Schriftkenntnis die Mehrheit ausmachten. Im Mittelalter ersetzte für weite Bevölkerungskreise die Kanzel die Schule; Pfarrer hatten einen breiten Lehrauftrag. Heute wollen klerikale Sonntagsredner·innen vor allem vermeiden, dass sich Kirchenbesucher·innen, die in ihrem Berufs- und Freizeitleben mit einer Fülle leistungsfähiger Wissens- und Unterhaltungsmedien umgehen, im Wortgottesdienst bei drögen Monologen langweilen. In der Homiletik hat man deshalb schon vor einiger Zeit einen „Koalitionswechsel […] von der Kommunikationswissenschaft zur Ästhetik“ (Gerhard Marcel Martin) propagiert. Predigten sollten sich, so lautete der Rat, ein Beispiel an der modernen Erzählliteratur nehmen und als offenes Kunstwerk angelegt sein, in dem die Appellstruktur von Leerstellen und Uneindeutigkeiten die Hörerschaft zur kreativen Mitwirkung bewegt
Die Förderung des selbsttätigen Lernens reicht pädagogisch dabei weiter zurück als man denkt. Schon im Mittelalter entwickelten findige Universitätslehrer für den juristischen Elementarunterricht Lernkartenspiele zur Reduktion des komplexen Stoffs. Im Gegenzug gewannen Erfordernisse der Lehre damit Vorrang vor der Treue zum Referenzwerk. Das Wissenswerte wurde mit dem Vermittelbaren gleichnamig. In gegenwärtigen akademischen Arbeitskontexten tritt ein analoges Dilemma in Zielkonflikten zwischen Forschung und Lehre auf, da Forschungen sich durch den Bezug auf „ein markiertes Nicht-Wissen“ rechtfertigen müssen, „das selber unterschieden und bezeichnet werden kann“ (Niklas Luhmann). Dagegen lebt die Lehre von der Weitergabe eines akzeptierten Wissens. Anfänger·innen finden auf dem Buchmarkt mittlerweile eine ganze Reihe von Einführungs- und Handbüchern, die sie bei den ersten Schritten begleiten. Für die Erforschung der Epistemologie von Beispielen, ihr Fort- und Nachleben abseits der rhetorischen Stoffsammlungen bieten sich mit solchen Materialien weitere, in der Wissensgeschichte bislang nur punktuell gewürdigte Studienobjekte.
Aufzeichnungen machen. Prägend ist die Rhetorik auch für die Steuerung von Mikroprozeduren im Ideenhaushalt geblieben. Die durch Manuale vermittelten Techniken des Notierens und Ordnens stabilisieren nicht nur eine langlebige Kultur des Exzerpierens, sondern spielen auch noch in Prozessen des Suchens, Entwerfens und Erfindens eine wesentliche Rolle und tragen dazu bei, das Aufzeichnen an regelmäßige Exerzitien und Beobachtungsrituale zu koppeln. Auch in Zukunft wird das Graduiertenkolleg sich deshalb mit den historisch wechselnden Praktiken des Notierens und Glossierens – mit denen auch die Genese des Essays verknüpft ist – befassen. Außerdem sind Arbeiten zu Formularen willkommen, die für die Habitualisierung von Wahrnehmungsweisen und Denkstilen die nötige paper technology bereitstellen. Dasselbe gilt für Fragebögen und Interviews, mit denen empirisches Erhebungswissen generiert wird.
Stärker als bisher sollen dabei zudem Kleinformen in den Blick treten, die für eine Kooperation verschiedener Autor·inn·en disponiert sind oder aber ihre eigene Vorläufigkeit und den Charakter des Geschriebenen als ,Zwischenstand‘ in Medien mit formal gekennzeichneter Informalität publik machen, um durch den Umlauf im beschränkten Kreis Anschlussarbeiten initiieren zu können. Man kann hier etwa an die vielen Varianten so genannter ‚grauer Literatur‘ denken: Berichte, Proceedings, Newsletter oder Working Papers, bei denen die sonst übliche Publikationsstandards unterschritten werden – durch kleinere Auflagen, kein Peer Review, den limitierten Vertrieb in schmuckloser Broschur für Abonnent·inn·en eines Verteilers oder neuerdings durch Links auf einer Mailinglist –, die Projekten dafür aber schon im Stadium der Unabgeschlossenheit zu einer Ausstrahlung in Fachkreise verhelfen können.
Fakten schaffen. Wissenschaftliche Zeitschriften wie die Philosophical Transactions of the Royal Society of London, das Journal des Sçavants und Miscellanea Curiosa Medico-Physica waren im 17. Jahrhundert nicht nur für die Einführung des kurzen wissenschaftlichen Artikels wegweisend, sondern schufen mit der kleinen Form zugleich die materiale Möglichkeit für die Detaillierung und getrennte Beobachtung von Fakten. Die allmähliche Verlagerung der wissenschaftlichen Neugierde vom Wunderlich-Monströsen zum Unscheinbaren und Gewöhnlichen war dabei begleitet von einer prononcierter auftretenden Rhetorik der Rhetorikvermeidung. Wenn Präzision, dem lateinischen Wortsinn von praecisio entsprechend, die „Abschneidung“ von Überflüssigem gebietet, so liefert dieses Ethos nicht nur eine Rechtfertigung für die Gradlinigkeit der Prosa (von prorsus, „geradewegs“), sondern lässt als Faktum überhaupt nur ein Artefaktum gelten, das erst durch die Reduktion aufs Knappe seinen nackten Kern enthüllt, sich aber genauso als Essenz und opaker Rest darstellen kann, der ein noch auszulotendes Entfaltungspotenzial in sich birgt. Im Eruieren solcher Potenziale liegt die Ratio von Skizzen und Notizen, die zwischen Einfall und Beobachtung, Gedankenspiel und nomothetischer Aussage, Faktographie und Epigrammatik changieren und in der Vielfalt ihrer Kleinformen an der Pluralisierung von Normen mitwirken, die Forschungsrationalitäten begründen. ,Wahr‘ und ,falsch‘ sind hier längst nicht die einzigen Urteilskriterien. Genauso erheblich ist für epistemische Prozesse die Abschätzung von ,Fruchtbarkeiten‘, ,Plausibilitäten‘ und ,Anschlussfähigkeiten‘ angestellter Vermutungen und eingeschlagener Fährten.
Dringlich erscheint die fortgesetzte Aufarbeitung der Formen und Verfahren wissenschaftlicher Faktenproduktion auch deshalb, weil sich in den Streit um ihre Belastbarkeit für Schlussfolgerungen oder Prognosen mittlerweile aggressiv Entscheider·innen aus Ökonomie und Politik einmischen, die innerdisziplinäre Kontroversen als Alibi für eigene Zwecke missbrauchen und Haftungs- und Handlungsforderungen mit der Begründung abwehren, dass Anklagen oder Appelle angesichts von interpretationsoffenen Sachlagen haltlos sind. Die medienwirksame Errichtung von ,Fakten-Fetischen‘ – d.h. von rhetorisch fabrizierten faitiches (Bruno Latour), die als Fiktionen unumstößlicher Gewissheit Generalnenner für alle Fakten sein und anderes Wissen als schwach begründeten Glauben diskreditieren sollen –, befördert derzeit die Verbreitung einer „Agnotologie“ (Robert Proctor), die sich wahlweise in hyperbolischer Skepsis oder offener Wissenschaftsfeindschaft artikuliert.
Kleinformen als „little tools of knowledge“ II: Exemplarische Praxisfelder
Praxeologie der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Während Arbeiten zur Geschichte der Natur- und Humanwissenschaften auf einigen der umrissenen Felder bereits an weit gediehene Forschungen anknüpfen können, etwa hinsichtlich der Verfahren des Notizenmachens oder der vielfältigen Typen von Fallgeschichten, haben vergleichbare Studien zu den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften erst vor Kurzem einen deutlichen Aufschwung erlebt. Für Ausdehnungen und Vertiefungen durch Untersuchungen, die beispielsweise der Kohäsionsbildung oder konfliktgetriebenen Auflösung von (Gelehrten-) Netzwerken, Schulen und Richtungen nachgehen, bieten Kleinformen wie Rezensionen, Briefe, Streitschriften, Motti, Grußadressen und Empfehlungsschreiben weiterhin ein ergiebiges, vielfach noch unerschlossenes Studienmaterial.
Noch in den Anfängen steckt überdies die Forschung zu Formgenesen, die durch Publikationsformate begünstigt werden: Bücher, Hefte, Zeitungen, Online-Medien. Ein eigenes Feld tut sich dabei ganz generell mit Fachdiskursen auf, die außerhalb der Universität entstehen, sich über Zeitschriften und Online-Plattformen organisieren und von Akteuren getragen werden, die Beobachter·innen und Fans in Personalunion sind. Besonders differenziert stellt sich die Situation in der Popkultur dar, wo theorieaffine Vordenker·innen ihrerseits Distanz zum Mainstream wahren und in Magazinartikeln kreative Reflexionsformen kultivieren, um die Gräben zwischen avanciertem Pop und kommerzieller Massenkultur intellektuell wie performativ zu befestigen. Das wiederum macht es für Forscher·innen, die sich an der Universität für Sub- und Jugendkulturen der Gegenwart interessieren, attraktiv, hier Bündnisse zu suchen.
Didaktische und pädagogische Initiationen. Das Kleinarbeiten des Wissens für die Unterweisung von Noviz·inn·en ist grundlegend für alle institutionell gehegten kulturellen Bereiche. In der Schule werden dazu schon seit längerem nicht mehr primär Lehrbücher eingesetzt, sondern Aufgabenblätter für das Arbeiten an Stationen. Für die Universität gibt es verschiedene Typen von propädeutischen Medien: Companions – als moderne Artverwandte des mittelalterlichen Vademecum – sind mit ihren kompakten Darstellungen anders angelegt als „Reader“, die bei der Aufnahme von Studies ohne enge disziplinäre Heimat oder lange Forschungstradition mit kommentierten Materialsammlungen helfen. Fachdidaktiker·inne·n wiederum ist aufgefallen, dass manche Kleinformen der pädagogischen Sache mehr schaden als nutzen. Aus diesem Grund verwarf man die „didaktische Reduktion“ als Irrweg der abstrakten Stoffvermittlung und favorisierte stattdessen das Wachsen der Schüler·innen an lebensnah gewählten Aufgaben. So stieg die Relevanz von Übungen durch Textsorten wie dem Aufsatz, mit denen Grundfertigkeiten des Erzählens und Argumentierens sowie der anlassbezogenen Stilwahl trainiert werden.
Wissens- und Wissenschaftspopularisierung. Kleine Formen können Zugangshürden gering halten und Fach- und Sachwissen als Gemeingut verbreiten. Auf dem Buch- und Magazinmarkt waren illustrierte Zeitschriften frühe Trendsetter solcher Popularisierungsdynamiken. Im 19. Jahrhundert gab das kleinen Textgenres Auftrieb, die als Bilder auftraten, zum Teil auch mit Bildern gedruckt wurden. Neben Skizzen waren Tableaus beliebt, die sich vielfach an der Ästhetik der Genremalerei orientierten. Derzeit ist eine Konjunktur von Spielformen zu beobachten, die kleine Prüfungsrituale mit sportlicher Kompetition verquicken. In diesem Rahmen kann das Prinzip des prodesse aut delectare noch Formate des Kurzauftritts vom Typ der Science-Slams legitimieren, in denen Vortragende – meistens Nachwuchswissenschaftler·innen – unter hartem Zeitdiktat Sachverstand und Entertainer-Qualitäten beweisen. Mittlerweile stehen Lecture Performances von Autor·inn·en und Künstler·inne·n auch bei Fachtagungen auf dem Programm und erfüllen dort die hybride Doppelfunktion eines Sachbeitrags wie eines Divertissements.
Arbeiten, die diesen Phänomenen nachgehen, werden in ihren Untersuchungen Ergebnisse von Forschungen zur „Materialität der Kommunikation“ berücksichtigen müssen, zu Kulturtechniken sowohl des Redens, Schreibens und Lesens wie des Zählens (im Hinblick auf Seiten, Kapitel, Zeilen, Verse, Bände, Fuß- oder Endnoten, Spalten, Listen etc.) und des Buchens (Tage- oder Hausbuchführung). Genauso sind medienhistorische Umbrüche in Rechnung zu stellen, die mit der Ausbreitung analoger, elektronischer und digitaler Medientechnologien einher gehen, schließlich sozial- und bildungsgeschichtliche Zugangsbedingungen zu Lehranstalten und Lernmedien.
Sammelaktivitäten – kleine Formen in größeren Corpora
Der zweite Arbeitsschwerpunkt des Kollegs ist mit den Praktiken und Medien des Sammelns verbunden, durch die kleine Formen verwaltet, gesichert und für die historische Überlieferung präpariert werden. Je kleiner die Form – so unsere Hypothese –, desto weniger verträgt sie den Singular, und desto eher ist sie auf Kollektionen oder andere Einlagerungen in Großformen angewiesen. Deshalb ist auch weiterhin die Untersuchung der medialen, generischen und editorischen Kontexte unerlässlich, in denen solche Formen gehortet, tradiert und rearrangiert werden und dadurch selbst zum Ferment für generische Evolutionen avancieren.
Bewährt hat sich der Ausgang von ausgewählten Sammlungen, die Kleinformen in paradigmatischen Werk- bzw. Großkomplexen verorten und in verschiedenartige Teil-Ganzes-Relationen integrieren. Deren typologisches Spektrum soll in der zweiten Förderphase durch die Einbeziehung der Lyrik um Kollektionen erweitert werden, bei denen die Teil-Ganzes-Relationen besonders intrikat sind. Exemplarisch können dafür Gedichtbände einstehen, die in der Forschung als „Zyklus“ apostrophiert werden, als Zeichen der besonderen ästhetischen Wertschätzung einer werkförmigen Komposition von Autor·inn·enhand. Andererseits ist eine Druckkultur, in der die materiale Buchgestaltung im Satzspiegel und bei der Platzierung von Seitenumbrüchen Rücksicht auf die strophische Binnengliederung von Gedichten nimmt, historisch alles Andere als selbstverständlich. Das lässt es lohnenswert erscheinen, die Genese und Evolution von Formen in künftigen Forschungen auch an entsprechenden Anpassungsleistungen der medialen Zirkulationsformate abzulesen und inverse Konzessionen von Kleinformen an die wechselnden Formatvorgaben der Medien genauer zu beobachten, in die sie Eingang finden.
Kleinformen als Sammlungsobjekte I: Funktionen des Hortens und Ordnens
Wissensreichtum anhäufen. Archive, Bibliotheken und Wunderkammern sind in den letzten Jahren vermehrt ins Blickfeld der Forschung geraten, und eingehend wurde an Speichertechnologien (von der Aktenablage über Registraturen, Karteisysteme und Zettelkästen bis hin zu Digitalisaten und elektronischen Datenbanken) gezeigt, wie diese zugleich an der (Re-)Produktion von Wissen, an der Stimulation literarischer Kreativität beteiligt sind. Damit sind wichtige Vorarbeiten geleistet, an die das Kolleg schon jetzt anknüpft. Eine besondere Herausforderung stellen die frühneuzeitlichen Thesauri, Analecta, Commonplace-Books und Aeraria poetica dar, die von der Literaturwissenschaft lange gemieden wurden, seit einiger Zeit aber auf reges Interesse stoßen. Es handelt sich dabei um Sammlungen von Gleichnissen, Sprichwörtern, Adagia und Sentenzen, die als „Schatzkammern“ rhetorischer Topoi für die inventioangelegt sind. Typologisch halten diese Kollektaneen die Mitte zwischen generisch enger festgelegten Formen der Kompilationsliteratur einerseits und dem Sektor der „Buntschriftstellerei“ anderseits, in der Disparatestes nach dem Prinzip unterhaltsamer Varietät vermischt wird.
Da die enorme Bandbreite dieser Mischliteratur bislang erst in Ansätzen erforscht worden ist, kann Graduiertenkolleg hier in größerem Maßstab Erschließungsarbeit leisten. Dabei wird man solche Formen, die bereits als selbständige Kleingenres in die Sammlungen eingehen – Spruchweisheiten, Maximen, Scherzfragen, Rechtsformeln, Legenden –, von anderen unterscheiden müssen, die durch Abbreviaturen, durch Isolation und selektives Zitiert-Werden überhaupt erst entstehen: als Exempel, Apophthegmata, Exzerpte oder ,verdaulich‘ portionierte Auszüge in Anthologien vom Stil des „Reader’s Digest“ oder der „Beauties of…“
Im Fall der Lyrik dürften in wissen(schaft-)sgeschichtlicher Hinsicht solche Sammlungen besonders aufschlussreich sein, die Gedichte als mustergültige Exempel für überzeitliche Vollkommenheitsideale anpreisen oder als repräsentativ für Stile und Bewegungen ausweisen. Dasselbe gilt für Kollektionen von Gesängen, die Auskunft über die orale Kultur indigener Völker in der Ferne geben, dabei ohne den Hintergrund der kolonialen Expansion Europas nicht denkbar sind. Die entdeckten ,Primitivismen‘ inspirierten in der Moderne sowohl künstlerische Aufbrüche aus dem Elan der Modernekritik als auch wissenschaftliche Pionierwerke.
Nur punktuell aufgearbeitet ist weiter, welche Effekte der transatlantische Export von Büchern und Zeitschriften im Gefolge der Kolonialisierung für die Globalisierung kleiner Genres und Formen und deren Transformation in anderen Literaturen, auch deren Überdauern in postkolonialen (Markt-) Konstellationen zeitigte. Wanderungsbewegungen dieser Art sind etwa im Fall von Aphorismen und Sprichwörtern zu beobachten, die in den ehemaligen Kolonien Frankreichs, Spaniens und Portugals als Genres populär wurden, dort aber autochthone Anverwandlungen erfuhren.
Wissenstypen differenzieren. Untersucht werden muss auch, wie diese Sammlungscorpora zur Ausdifferenzierung von Wissenstypen – nach Weisheiten, Erfahrungsregeln, Erfolgsrezepten, kanonischem, häretischem oder esoterischem Wissen, offenen und intimen Geheimnissen – beitragen. Davon hängt ab, inwieweit dieses Wissen privat bewahrt oder publik werden soll. Anekdotensammlungen etwa zehren davon, dass sie Geschichten kolportieren, die Historikern als zu heikel oder nichtig gelten. Ihre Basis ist das Historem, verstanden als „smallest minimal unit of the historiographical fact“ (Joel Fineman). Anlass für das Ausbreiten von Randständigem anderen Typs – in Gestalt von Paralipomena, Exkursen, Quaestiones – wiederum bieten seit der Zeit des Humanismus Kommentare, in denen einzelne Gemeinplätze Aufhänger sein können für ein eklektisches Allerlei von Wissenswertem unterschiedlichster Provenienz. Schließlich ist an Sammlungen denunziatorischen Charakters zu denken: Kollektionen wie die von katholischen Legenden und Mirakel-Erzählungen etwa, die Luther und andere Akteure der Reformation mit kritischen Kommentaren unter dem Namen „Lügende“ in Umlauf brachten.
Wissenserwerb leicht machen. Weil solche Kompilationen sowohl in einem Konkurrenz- als auch in einem Allianzverhältnis zu Enzyklopädien und Romanen wie zu Zeitungen und Zeitschriften stehen – darauf verweist bereits die Mehrdeutigkeit des Magazinbegriffs, der ursprünglich einen Stauraum bezeichnet; Online-Archive wie JSTORrücken diese Semantik wieder stärker in den Vordergrund –, muss außerdem geklärt werden, in welcher Weise solche Kompilationen nicht nur das selektive Interesse ihrer Verfasser·innen und Herausgeber·innen bedienen, sondern auch das der Leserschaft. Das betrifft deren Lese-, Auslese- und Nichtlese-Gewohnheiten, die durch die Textökonomie und materiale Ausstattung der Sammelwerke und Magazine bedient werden (Typographie, Bild-Text-Verhältnis, Layout, Papier- und Buchformat), dann die zeitliche Strukturierung von Lektüren, außerdem den Wechsel zwischen Innehalten („Skimming“) und Überfliegen („Skipping“), den Anthologien im Stil der „Beauties of…“ ihren Leser·inne·n durch die Alternanz von wörtlich zitierten Stellen und raffenden Zusammenfassungen antrainieren.
Hinzu kommen zum zweiten die sozialen Gesprächsrituale und mündlichen Kanäle des ,Geredes‘, an denen solche Thesauri ausgerichtet sind. In barocken Kompilationswerken wie den „Conférences“ (Théophraste Renaudot) oder „Gesprächsspielen“ (Georg Philipp Harsdörffer) z.B. wird enzyklopädisches Wissen spielerisch vermittelt, im Rahmen einer inszenierten Unterhaltung, die ebenso geistreich wie „kurzweilig“ sein und durch ihre Gesprächsstoffe auch die Konversationskultur der LeserInnen befördern soll.
Von dort führt ein direkter Weg sowohl zu den apostrophierten „Conversations-Lexika“ des 18. und 19. Jahrhunderts, die ein „kurz gefaßtes Handwörterbuch für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus den Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände mit beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der älteren und neueren Zeit“ (Untertitel des Brockhaus von 1809) liefern wollen, als auch zu den nachmaligen Sammlungen des mündlichen Zitatwissens von Zeitgenossen: Büchmanns „Geflügelten Worten“ oder Flauberts Dictionnaire des idées reçues, in dem Geflügelte Worte relativ rar sind, dafür aber der realistische Roman als Archiv bourgeoiser Gemeinplätze ausgebeutet wird.
Kleinformen als Sammlungsobjekte II: Paradigmatische Werkkomplexe
Referenzwerke. Unter den Sammelwerken besitzen jene Corpora einen besonderen Rang, die durch ihren Aufbau, ihre In- und Exklusionen eine Referenzfunktion gewonnen haben und für die Pflege von Professionen und Künsten sowie für die Hegung von Disziplinen konstitutiv geworden sind. Ohne Thora, Bibel und Koran gäbe es keine Theologien, ohne Gesetzeskodices kein Recht, ohne Beispielsammlungen keine Kasuistik, ohne Magazine von Fallgeschichten oder Sammlungen von Märchen, Sagen, Mythen und Volksliedern keine Erfahrungsseelenkunde und Kriminologie, keine Volkskunde, Ethnologie und Psychoanalyse. Einen analogen Status können für die Einweisung in Künste – die Koch- oder Arzneikunst z.B., aber auch die Rede- und die Dichtkunst – Rezeptsammlungen beanspruchen, die ein lokal gehütetes oder von Eliten bewahrtes Praxiswissen auf den Punkt von Maßen und Formeln, Regeln und to do-Listen bringen, um auf diese Weise dessen kontrollierte Weitergabe zu ermöglichen.
Verbunden mit dieser Erfassung von Kleinformen als Exempel, Regeln, Fälle usf. sind in den betreffenden Kollektionen redaktionelle Eingriffe und zielgerichtete ,Reinigungen‘, die sicherstellen, dass die Einzelstücke wahlweise als integrale Teile eines gegliederten Ganzen, als repräsentative Muster, als typische Exemplare, ersetzbare Proben, Überlieferungsreste oder als Unikate zur Geltung kommen und die Sammlungen entweder als geschlossene – vollständige – Corpora oder als offene – zu fortgesetzter Akkumulation einladende – Aggregate adressiert werden. Auswahl, Anordnung und Sequenzbildung können dabei ihrerseits dem Vorbild anderer historischer oder zeitgenössischer Sammlungen abgeschaut sein und Traditionsbezüge herstellen oder kappen.
In künftigen Studien ist prononcierter auch auf ein etwaiges Nebeneinander verschiedener Ausgaben zu achten, die in Format, Umfang und Ausstattung variieren, außerdem auf Skalierungsanpassungen bei aufeinander folgenden Auflagen, auf Rezeptionsverschiebungen durch ergänzte Vorworte oder Anmerkungen, auf Eingriffe im Zuge von Übersetzungen.
Collected Works. Ein wieder anderer Stellenwert wächst Kleinformen im Kontext von Sammlungen zu, die Lebenswerke bilanzieren, Charakterstudien anstellen oder über die Entwicklung von Subjekten Buch führen. Das Spektrum solcher Sammlungen reicht von staatstragenden Enzyklopädien wie der Biographia Britannica – einem Archiv kompakter Lebenslauf-Darstellungen von „most eminent persons“ im Dienst der englischen Nationalgeschichtsschreibung – über Kurzporträt-Reigen vom Typ der Brief Lives John Aubreys bis hin zu handschriftlichen Ego-Dokumenten großer Männer aus der Wissenschafts- und Technikgeschichte. Dazu kommen Tagebuchnotizen, Essays und Briefwechsel als Kleinformen einer écriture de soi. Diese wiederum lassen für introvertierte Meditationen ebenso Raum wie für Sprünge von Witz und Laune, auch für spontane Eingebungen in der jeweiligen „Schreibszene“ (Campe 1991).
Eigene Studien verdienen in diesem Kontext Editionsprojekte, die das Schriftwerk Einzelner gebündelt darbieten, geleitet durchaus von werkpolitischen Kalkülen. Im 19. Jahrhundert verbreitet sich die Palette von Collected Works, an deren Spitze die Gesamtausgaben einzelner Autoren stehen. Dass solche Ausgaben nicht nur unter allerhand kleinen Schriften anschwellen, sondern auch mit verworfenen Varianten sowie anderweitigen Bruchstücken aus dem Nachlass aufwarten – letztere oft auratisiert durch Faksimiles der Handschrift –, macht auf Seiten der Leserschaft die Würdigung solcher Aufzeichnungen nicht nur bequem möglich, sondern regelrecht zur hermeneutischen Pflicht. Eine andere Möglichkeit, Zerstreutes – jetzt im Sinn verstreut publizierter Kleinigkeiten – zusammenzutragen, bietet sich Autor·inn·en durch den narrativen Einschluss in Prosawerke zweiter Ordnung. Man kann das an Novellensammlungen im Stil des „Decameron“ zeigen, die im 19. Jahrhundert häufig durch Zweitverwertungen von Erzählungen zustande kommen, inseriert nun in Rahmenhandlungen, die deren Erzählt-Werden nachträglich motivieren, und zwar wiederum durch Gesprächsspiele.
Zugleich bleiben solche Konstruktionen fragil und lassen die Disparatheit der kleinen Geschichten in der Großerzählung keineswegs aufgehen. Inwieweit kleine Formen Anlass geben, um grands récits überhaupt mit Skepsis zu begegnen und Subsumtionen abzuweisen, steht nicht nur in der Literatur zur Debatte, sondern spätestens im 20. Jahrhundert auch in der Geschichtsschreibung. Ausdruck epistemologischer Skrupel werden dann Ansätze wie die microstoria sein, die aus partikularen Fallgeschichten, die anderen eine Fußnote wert sind, ganze Monographien heraustreibt. Dem entspricht im New Historicism der programmatische Rekurs auf Anekdoten, in der Sozialgeschichtsschreibung der Literatur – die damit ebenfalls wissenschaftlichen Reformbedarf anmeldet – der Verzicht auf Individualmonographien einsamer Fachgrößen zugunsten von Sammelbänden mit verteilter Autorschaft.
Serien – Alben – Netzwerke. Von solchen Kompilationen abzuheben sind die Verkettungsprinzipien von Serien, die insbesondere für die populäre Medien- und Wissenskultur prägend sind. Auf Kleinformate abonniert – die nicht umsonst in Groschenheften und Taschenbüchern zirkulieren –, entwickeln sie eine Vielzahl von Verfahren, um ihr Publikum für Fortsetzungen zu interessieren, die keine sequels sein müssen, sondern auch durch Reihen, Remakes oder transmediale Adaptionen garantiert werden können. Ähnlicher Beliebtheit erfreuen sich Alben, die als Bücher im Potentialis Freiraum für provisorische und reversible Kombinationen von Kleinformen und -bildern lassen, aus denen kein Werk hervorgehen muss
Mit ihrer Ordnung der Wiederkehr stimulieren solche Alben im Kleinen, was das Web 2.0 im Großen umsetzt, in dem es auf elaborierter technologischer Basis unendlich viele Verknüpfungsmöglichkeiten durch Links ermöglicht. User werden durch solche neo-enzyklopädischen Strukturen zum cut & paste animiert, sind aber auch – in den Grenzen, die ihnen Programme und Apps setzen – zur Kollaboration eingeladen. Buchverlagen wiederum und Digital-Archiven – Project MUSE, JSTOR – eröffnen sich hier neue Möglichkeiten der ,Entbindung‘ von Hard- und Softcoverprodukten zum Separatvertrieb von Aufsätzen und isolierten Buchkapiteln, so dass sich intellektuelle Inhalte vollkommen unabhängig von den publizistischen Formaten, in denen sie ursprünglich erschienen sind, zur Kenntnis zu nehmen lassen. Übrig bleibt vom materialen Buch im Netz ein virtuelles Konto, auf dem neue Eingänge listenförmig verbucht werden: der Account.
Für die popkulturelle Bewirtschaftung der Plattformen und Social Media-Kanäle hat die mitlaufende quantitative Auswertung von Klicks dabei den Vorzug, dass Follower durch Rankings verfolgen können, was anderen Userngerade gefällt, und so leicht Interessenkoalitionen bilden, auch neue Stars küren können. Für die Avantgardekunst im frühen 20. Jahrhundert leisteten kleine, nicht-kommerzielle Magazine diese Vernetzung und bewirkten, dass die Ästhetiken des Modernismus auch abseits der Metropolen in Europa und den USA verbreitet wurden. „No little magazines, no modernism: it’s as simple as that“ (Eric Bulson). Aufmerksamkeit verschafften ihnen nicht zuletzt avancierte Heftlayouts mit plakativer Typographie.
Aktualitätsprogramme kleiner Formen
Der dritte Arbeitsschwerpunkt des Kollegs bleibt auch in Zukunft den ästhetischen, medientechnischen und ökonomischen Spielräumen gewidmet, die kleine Formen ausschöpfen, um auf Aktualitätsforderungen zu reagieren. Die übergeordnete Forschungsfrage richtet sich damit auf die Funktionalität und Attraktivität solcher Formen für die Information und Reflexion der Gegenwart über sich selbst. Wir untersuchen, welche Kleinformen dem Anspruch auf Zeitgemäßheit im Gefolge medialer Innovationsschübe besonders entgegenkommen und wie sich durch sie die Kriterien des Wissenswerten verändern. Außerdem interessieren uns die ästhetischen Verfahren, mit denen sie sich dem entstehenden Zeitdruck anpassen oder gegen ihn auflehnen und damit zugleich im Aktualitätswettbewerb mit anderen Kleinformen und Medien behaupten.
In der künftigen Arbeit des Kollegs möchten wir dabei insbesondere ausloten, wie sich kleine Prosa- und Versformen gegeneinander ausdifferenzieren. Zu untersuchen ist, unter welchen artistischen, ökonomischen und medialen Knappheitsgeboten ihre Grenzen fließend werden. Wir erhoffen uns davon auch weitere Auskünfte über Beitrag kleiner Formen zur Modellierung von Geschichtsbegriffen, den von ihnen ausgehenden Impulsen zu deren Differenzierung oder Verwerfung. Dann interessiert uns die Mobilisierungskraft kleiner Formen: die Agency, die sie als Movens für Polarisierungen und Versammlungen entfalten.
Kleinformen als Zeitsonden I: Innovationsleistungen
Zeitschichten differenzieren. Kleine Formen gelten als große Nutznießer, Zeugen und Schrittmacher einer Moderne, zu deren Signaturen die Beschleunigung gehört – nicht zuletzt, weil Presse, Photo- und Phonographie, Telefon, Funk, Fernsehen und digitale Medien das Begehren nach immediacy steigern. Damit ist zunächst die Ausdifferenzierung der Kleinprosa verbunden, die seit der Sattelzeit von einer intensiven, (geschichts-)philosophisch dominierten Reflexion und Neubestimmung des Prosabegriffs selbst begleitet wird. Um ihn zentrieren sich großräumige Zeitdiagnosen, die an den Veränderungen der Gegenwart zugleich deren Kontingenz konstatieren, wenn sie diese mit Attributen des Zerfalls verbinden. Je nach Perspektive kommt die Prosa dabei entweder als Revers eines Verlusts stabiler Ordnungen in Betracht oder als Resultat historischer Prozesse der Komplexitätssteigerung, die mit Rationalisierungs-, Technisierungs- und Verwissenschaftlichungsschüben erklärt werden.
Für die Poesie eröffnen sich im Zuge dieser Entwicklungen eigene Spielräume der Erneuerung und des ausgestellten Traditionsbruchs. Einerseits verlieren mit der Emphase moderner Freiheiten die hergebrachten Gebote des Aptums an Verbindlichkeit und provozieren transgressive, unorthodoxe Aneignungen alter Formenrepertoires. Andererseits entfällt mit der Befreiung von alten Verbindlichkeiten auch die Notwendigkeit des Festhaltens an Bindetechniken wie Vers und Reim. Die Ästhetisierung von ehemals pragmatischen Gebrauchsformen und die Minimierung der Distanz zur Prosa, die Profanisierung gerade auch der ehrwürdigsten Traditionsbestände sind zwei komplementäre Tendenzen, mit denen sich moderne Standortbestimmungen verbinden lassen. Der Futurismus bringt das auf den Punkt der schrillen Kampfansage gegen alles „Passatistische“ (Filippo Marinetti). Doch auch andere Vertreter·innen moderner Ästhetiken kultivieren den Tabubruch durch eine kalkulierte Verletzung heiliger Bezirke. Auffallend häufig werden in Lyrik und Prosa religiöse Gebets- und Liedformeln entlehnt, zersetzt und pervertiert. Andererseits haben Primitivismen Konjunktur. Ähnliches lässt sich in den sub- und jugendkulturellen Binnenregionen des Pop beobachten.
In exemplarischen Analysen bleibt näher zu sondieren, wie die aus diesen Auseinandersetzungen hervorgehenden poetischen und prosaischen Kleinformen die Differenz von Poesie und Prosa bearbeiten und die Behandlung des Unterschieds als wichtigen oder nichtigen zur zeichenhaft einsatzbaren Variable machen, um sich selbst als up to date, als avantgardistisch, anachronistisch oder zeitlos zu profilieren. Das schließt die Untersuchung von Ungleichzeitigkeiten innerhalb der beleuchteten Perioden ebenso ein wie die von Kontinuitäten über die Epochenbrüche hinweg.
Gegenwartsreflexion. Ihren entscheidenden Auftrieb erhält die Nutzung und Verbreitung kleiner Formen seit dem 15. Jahrhundert durch die Druckerpresse, die Kalender und Flugblätter en masse unters Volk bringt, um saisonal Relevantes oder Tagesaktuelles, Sensationelles oder Skandalöses zu kolportieren und zu illustrieren. Zum Inbegriff von kleinen Formen sind unter den Novitäten besonders jene Spielarten der Kurzprosa avanciert, die seit dem späten 18. Jahrhundert in Zeitschriften und Zeitungen gepflegt wurden. Das beginnt bei Romantiker-Fragmenten, die sich in ihrer ausgestellten Vorläufigkeit auf Prozesse des Werdens hin entwerfen, und führt über die journalistische „Zeitschriftstellerei“ von Autoren, die sich als „Geschichtstreiber“ statt als „Geschichtsschreiber“ (Ludwig Börne, Briefe aus Paris) begreifen, bis hin zu kurzlebigen Modeberichten, physiologies des Pariser Gesellschaftslebens, tagespolitischen Karikaturen und Großstadtfeuilletons.
Durch die fortgeschrittene Digitalisierung großer Zeitungscorpora ist es mittlerweile leichter möglich, solche Feuilletons in der medialen Umgebung der Zeitungsseiten zu untersuchen und ihre Zirkulationsgeschichte, die nur im Ausnahmefall mit nachmaligen Auswahl- oder sogar Gesamtausgaben verknüpft ist, differenzierter nachzuzeichnen. So kann auch verfolgt werden, wie die Feuilletons sich mit ihrer Form zu den Produktions-, Vertriebs- und Rezeptionsbedingungen der Zeitung verhalten, wie sie aber auch mit der Informationspolitik ,über dem Strich‘ interagieren – z.B. durch eigene Formate der Serienbildung. Im Gegensatz zu solchen pragmatischen Aspekten sind die ästhetischen Reize der kleinen Feuilletonprosa schon früh als wesentlicher Attraktor wahrgenommen worden. Die gesuchte Literaturnähe zog meist allerdings abfällige Kommentare auf sich und brachte der Mehrzahl der Feuilletonist·inn·en in der Zeitung zwar Geld ein, mehrte aber selten ihren literarischen Ruhm.
Schon deshalb müssen die Distanzierungsgesten mitbeleuchtet werden, mit denen solche journalistisch-literarischen Hybridformen innerhalb der Zeitung – wenigstens rhetorisch – klein gehalten werden, außerdem entsprechende Abgrenzungsmanöver auf dem Terrain der Erzählliteratur, auch seitens der betreffenden Autor·inn·en selbst. Kontrastiv sind dem literarische Klein- und Großformen gegenüberzustellen, die durch formale Anleihen bei kleinen Medienformaten ostentativ Zeitgenossenschaft herstellen. Das liegt im Kontext von Programmen des Realismus und der Sachlichkeit nahe, ebenso der avantgardistischen Literatur, dann im Feld der politischen Lyrik. Auch die Pop-Literatur kommt dafür in Frage, wobei deren Verhältnis speziell zum Feuilleton aufgrund der kultivierten Geringschätzung des Mainstreams, zu dem an vorderster Stelle die bürgerliche Kultur zählt, mehrfach gebrochen ist.
Neuigkeiten notieren. Die Beschleunigung und Erleichterung von Fernkommunikationen bringt seit dem 19. Jahrhundert eine Erweiterung des Spektrums der Faktographie mit sich. Im journalistischen Tagesgeschäft erhält die Notiz eine neue Funktion. Aufgezeichnet werden jetzt keine Beobachtungen und Einfälle, sondern Vorfälle. Durch die knappe Mitteilungsform ist ein Minimalabstand zwischen Geschehen und Meldung garantiert, der nicht nur die Kolportage von Neuem, sondern von „Neuestem“ erlaubt. Eine systematische Dimension gewinnt die Sicherstellung von Aktualität durch Updates dort, wo die Korrelation von kleiner Form und Neuigkeit definiert, was Information heißt. Inzwischen erfüllen digital zu abonnierende Newsfeeds diese Funktion.
Als Neuigkeit wird das journalistische Faktum – das unterscheidet es von der wissenschaftlichen Tatsache – nicht für spätere Verwertungen festgehalten. Es fordert Aufmerksamkeit dadurch, dass es „das Infinitivische einer noch unabgeschlossenen Gegenwart in das Partizip Perfekt des Faktischen überführt und in dieser vorläufig definitiven oder definitiv vorläufigen Form zur Kenntnis bringt“ (Juliane Vogel). „Tatsachen“ vom Typ der faits divers, deren Konjunktur nicht von ungefähr steigt, als Presseagenturen für den raschen Umschlag von Telegraphiemeldungen aus aller Welt auf dem Nachrichtenmarkt sorgen, sind das Paradebeispiel für Kleinstnotizen, mit denen sich das Wissenswerte auf die Merkwürdigkeiten des Alltags ausdehnt und das Wunderbare neben dem Monströsen imGewöhnlichen aufscheint: in Lottogewinnen, glücklichen Rettungen, Unfällen, Gaunereien oder mysteriösen Todesfällen. In der Rubrik des „Vermischten“ sammelt die Presse allerlei bunte Realitätssplitter auf, die sich auch in dem Sinn als nackte Tatsachen darstellen, dass sie sonst nichts preisgeben und mithin ungewiss bleibt, ob dahinter eine Geschichte steckt, die ausgegraben zu werden lohnt.
Kleinformen als Zeitsonden II: Hotspots der Aktualitätsbewirtschaftung
Novellistik. Literarisch profitiert vom enormen Wachstum des Faktenmarkts als erste die Novelle, die von den Stoffvorräten der tradierten historia abrückt, von der Lizenz zur blanken Fiktion aber selten Gebrauch macht und dem Erfinden das Vorfinden vorzieht. Unter verschobenen Vorzeichen kommen Prinzipien der rhetorischen inventio dort neu zur Geltung. Ebenso begierig saugt die Novellistik das mündliche Gerede auf und kolportiert die Geschichten, die dort zirkulieren, selbst alte Sagen. Wenn man das nicht als Regression beargwöhnen oder, umgekehrt, der Progressivität einer Erzählliteratur zugutehalten will, die ihr höheres Niveau beweist, indem sie die Einfachheit oraler Formen ,vorführt‘, so wird man die komplexen zeitgenössischen Nachrichtenlagen eingehend studieren müssen, in die sich die Novellen einschalten – nicht zuletzt, weil sie ihr Publikum selbst über Zeitungen und Zeitschriften erreichen.
Avantgarden. In den Avantgarden seit 1900 findet die Lakonik der kleinen Faktenprosa einen eigenen Resonanzraum. Demonstrativ wird hier gezeigt: „Kürze ist modern“ (Michael Gamper/Ruth Mayer). Dafür stehen experimentelle Schreibweisen und Ästhetiken des Minimalismus ein, in denen Lyrik und Prosa – wie zuvor schon in Baudelaires wegweisenden Petits poèmes en prose (1857) – einander weitgehend assimilieren. Im Gegenzug wächst damit der Rätselcharakter der Kleinformen. Es entstehen Texturen an der Grenze der Unverständlichkeit, in denen auch das Banalste bizarr wirkt und Skurriles normal erscheint. In spanischen und lateinamerikanischen microrrelatossowie amerikanischen Formen der sudden fiction oder flash fiction finden solche Mikroerzählungen jüngere Nachfolger.
Andererseits motiviert der Anspruch, an der Radikalverfremdung der Wirklichkeit zu arbeiten, um das Neue an ihr freizulegen, kollektive Sammelaktivitäten im Interesse des Dokumentarischen. Sergej Tret’jakov zum Beispiel beginnt im revolutionären Russland, knappste „očerks“ (Skizzen) anzufertigen, um auf dem Weg des reflexionslosen Schnellschreibens die eigene Wahrnehmung zu entautomatisieren. Wenn zur selben Zeit die Aktivisten des DADA zur Schere greifen, um das Material ihrer Collagen aus Zeitungsabfällen zu generieren, so stehen hinter diesen cut & paste-Techniken hingegen maliziöse Zeitbeobachter, in deren Montagen die Restwelt ihre eigene Absurdität sehen soll. Derzeit kommt dem zumindest dem Verfahren nach eine Popliteratur nahe, die Songfetzen, Werbeslogans und Markennamen aufliest und Romane als Enzyklopädien von Zitaten mit generationellem Signalcharakter anlegt. Hier sind neue Archivisten am Werk, deren Arbeitsformen sich als Aktualisierungen älterer Exzerpierpraktiken studieren lassen – wobei die Notationen nun Kommunikationen festhalten, die sich „gerade eben jetzt“ (Eckhard Schumacher) ereignen.
Plattform Internet. Wer ein Smartphone besitzt, kann solche Rückkopplungen der Gegenwart mit sich selbst inzwischen ohne Mühe schreibend, lesend, audiovisuell und telekommunikativ herstellen, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Die millionenfach genutzten Internet-Plattformen bieten als „soziale Medien“ dafür Infrastrukturen, die für Postsaller Art empfänglich sind und sie zu ,Informationen‘ egalisieren, die so ungebunden zirkulieren dürfen wie nirgends sonst.
Unter Berufung auf das demokratische Grundrecht freier Rede sind durch den Obersten Gerichtshof in den USA schon Ende der 1970er Jahre rechtliche Hindernisse abgebaut worden, die dem „freien Fluss kommerzieller Informationen“ (Herbert Schiller) im Weg standen. Seit 1996 ist ein Communications Decency Act in Kraft, der sowohl Provider als auch User von der Haftung für das Verteilen von ,Informationen‘ – Texten, Bildern, Videos – ausnimmt, wenn Andere diese einstellen. Durch solche Freibriefe für das Zustellen von Content an die Inhaber·innen entsprechender Konten wurden die Bedingungen dafür geschaffen, dass das Meinungshafte schlechthin, die freie Rede ohne Haftung, Rechtfertigung oder Begründungszwang, zum allgemeinen Maß von Äußerungsakten schlechthin geworden ist. Das nutzen Medienkonzerne wie Facebook, um ,Informationen‘ in derart hochskalierten Mengen zu vertreiben (z.B. 6.000 Tweets pro Sekunde auf Twitter oder drei Millionen Posts pro Minute auf Facebook), dass die Konformität der Posts mit anderen Rechtsnormen und Zivilitätsstandards von keinem mehr geprüft werden kann. In der Forschung hat man von einer digitalen Reformation, einem „digitalen Protestantismus“ (Evgeny Morozov) gesprochen, weil die ungebremst verteilten Botschaften nicht mehr von institutionellen Schwellenhüter·inne·n gefiltert, interpretiert, zensiert und ,verfälscht‘ werden, sondern der Allgemeinheit mit der Lizenz zur Selbstbedienung für den Privatgebrauch zugehen.
Für das Graduiertenkolleg sind an den davon begünstigten Kommunikationsgewohnheiten die Neo-Primitivismen aufschlussreich, die hier in unterschiedlichen Spielarten auftreten. In der russischen Internetliteratur floriert beispielsweise eine sich ostentativ dilettantisch gebende Kurzprosa, in der die zur Schau gestellte Einfalt – auch bei der karnevalesken Betitelung der Stücke als Aphorismen, Kurzmärchen, Haikus und Gebäcksorten – eine dissidente Haltung maskiert. Über die minima banalia dieser Popkultur, ihre Empfänglichkeit auch für den simpelsten Beitrag wird zugleich ein demokratisches Egalitätsversprechen erneuert: Jede·r kann mitmachen. In Buchblogs wiederum, auf denen sich deutschsprachige User versammeln, verbindet sich mit dem Austausch über persönliche Lektüreerfahrungen ein kultivierter Affekt gegen Expertenurteile aus Wissenschaft und Feuilleton. Widerstandsattitüden, die während des 20. Jahrhunderts vor allem für die Bohème um minoritäre Kunst- und Subkulturszenen typisch waren, begegnen hier als konditionierter Reflex schreibender Leser·inne·n, die mit ihren Passionen mehrheitsfähig sein wollen, darum auf unmittelbare soziale Anschlussfähigkeit bedacht sind und sich bei ihren Statements kurz fassen, um prompte Reaktionen aus der mitlesenden Netzöffentlichkeit zu stimulieren. Nichts ist in dieser Lage misslicher als das Äußern von Urteilen, die niemand ,teilt‘. Aggressiv werden die Affordanzen kommunikativer Kurzformen auf Messengerdiensten wie Telegram mit News genutzt, die für die Empfänger·innen nicht neu sind, aber trotzdem begierig aufgenommen werden, weil sie die Lesegemeinde in ihrem Glauben bestätigen, so dass weitere Kontroversen sich erübrigen.
Das Graduiertenkolleg wird sich in seiner Auseinandersetzung mit den Formen der Faktographie darum auch mit der Fabrikation „alternativer Fakten“ und ihrer Relevanz für die Kohäsionsbildung in den tribalistischen „Neogemeinschaften“ (Andreas Reckwitz, Michel Maffesoli) der Gegenwart beschäftigen müssen. Dabei kann es jedoch weniger darum gehen, den Artefaktcharakter aller Fakten abzustreiten, als nach den materialen und medialen Möglichkeitsbedingungen unterschiedlicher Arten ihrer Fetischisierung zu fragen. Die Diskussion der Formökonomien, die Formlosigkeiten zugunsten einer Autonomie von Inhalten – Content – privilegieren und diese als ,Informationen‘ kommerziell nutzbar machen, muss außerdem die Geschäftsmodelle und Gewinnkalküle von Plattformfirmen miteinbeziehen. Im Gegensatz zu Verlagen und Redaktionen sind Plattformen von Verpflichtungen der Haftung und des Urheberrechtsschutzes entlastet und können daraus Kapital schlagen.
Die so geschaffenen Fakten haben auch Folgen für das wissenschaftliche Wissen, für die Erwartungen an seine bequeme Zugänglichkeit – und für die damit verbundenen Kosten. Schon jetzt ist absehbar, dass der „Datenkapitalismus“ (Michael Hagner) in Open Access-Journals die Kosten für Autor·inn·en, die das symbolische Kapital des renommierten Publikationsorts mitabschöpfen möchten, selbst bei kleinen Aufsätzen gewaltig in die Höhe treibt.
Theoriegeschichte kleiner Formen
Die Aufarbeitung der Literatur- und Wissensgeschichte kleiner Formen muss die Erforschung der Theoriegeschichte von Formkonzepten einschließen. Darin kommen die kleinen Formen sowohl als Gegenstände der Reflexion in Betracht wie als Formen, in denen solche Reflexionen – auch über große Formen – sich vollziehen. Zu klären ist in unseren Diskussionen dabei einerseits, welche historischen Formbegriffe aus dem Kontext von Rhetorik, Poetik und Literaturtheorie vorauszusetzen bzw. zu aktualisieren sind, um den Formcharakter der jeweils beleuchteten kleinen Formen zu kennzeichnen. Andererseits muss sondiert werden, welches analytische Vokabular die Autor·inn·en bzw. Herausgeber·innen von sich aus anbieten, um den Kleinformen in ihrer Eigenart gerecht zu werden. Dann werden wir die Auseinandersetzung mit aktuellen Theorienansätzen fortsetzen, die bei der Profilierung geeigneter Formbegriffe über die historischen Terminologien hinaus hilfreich sein können. Damit ist die Herausforderung verbunden, die Formbegriffe über ihr Verhältnis zu Gattungs- und Medienbegriffen zu schärfen und ihre abweichenden Pointierungen kenntlich zu machen. Schließlich muss untersucht werden, welche Aufwertungen bzw. Stigmatisierungen mit ihrer Adressierung als kleine Formen verbunden sind, worin dabei ihre Vorzüge bzw. Defizite gegenüber Großformen wahrgenommen werden. Besonders interessiert uns, in welcher Weise das „Kleine“ in solchen Kontexten zum Gegenstand literaturtheoretischer Programmatik wird.
Rhetorik. Kleine Formen werden in der griechischen und römischen Rhetorik als „Gemeinplätze“ für den kommunikativen Wiedergebrauch erfasst und spielen insbesondere im Teilbereich der Topik eine Rolle, wobei der Aufbau solcher Inventare unterschiedlich begründet wird. Neben Desideraten der inventio kommen hier Maßgaben der elocutio in Betracht, die sich mit der Auszeichnung von Stiltugenden – z.B. der brevitas, die im Kolleg intensiv untersucht worden ist – verbinden. Weitere Sondierungen auf diesem Feld sollen sich künftig auf die Frage konzentrieren, wie sich kleine Vers- und Prosaformen in Mittelalter und Früher Neuzeit gegeneinander profilieren. Ebenso lohnenswert erscheint es, historische Debattenschauplätze aufzusuchen, an denen solche Kleinformen in die Kritik geraten bzw. an denen ausgehandelt wird, durch welche Neulegitimationen und daraus abgeleiteten Reformanstrengungen sie das vorgebliche Ende der Rhetorik überdauern.
Poetik und Ästhetik. Auf dem Fundament der Rhetorik basierend, sind es vor allem die im 16. und 17. Jahrhundert in Italien, Frankreich und England entstehenden Poetiken, die im Interesse der Sicherung gelehrten Regelwissens an der Zusammenstellung eines Katalogs von Normen arbeiten. Dass die Regulierungseffekte dieser Lehrwerke auf Europas Literatur sich tatsächlich in Grenzen gehalten haben dürften, tut der Langzeitwirkung keinen Abbruch, mit der diese Poetiken den geschmacksrichterlichen Diskurs über Dichtung und Literatur geprägt haben.
Davon profitiert zunächst allein die Versdichtung, wo die kleinen Formen sogar eine große Wertschätzung genießen. Schon für die Kunstbegriffe der Antike setzen Elegie, Satire und Epigramm höchste Maßstäbe, weil ihr beschränkter Umfang wahre Meisterschaft verlangt. Dagegen kommt die kleine Prosa in diesen Verständigungen nicht in Betracht. In den alteuropäischen Ordnungen des Redens und Schreibens bleibt ihr Stellenwert trotzdem solange unangefochten, wie ihr durch die Rhetorik pragmatische Funktionen und klar bezeichnete soziale Einsatzorte zugewiesen sind.
Das ändert sich, als die Verbindlichkeit der Redekunst und ihrer Regeln und Erfolgsrezepte erodiert und Ästhetiken entstehen, die zwar die Prosa neu bewerten, dabei aber vor allem auf den Roman Bezug nehmen. „Hierdurch wird die Kleine Prosa gleich mehrfach ausgegrenzt: sie ist keine große Prosa, und sie ist keine kleine Lyrik“ (Thomas Althaus/Wolfgang Bunzel/Dirk Göttsche). Nicht nur die emergierenden Formen der Kleinprosa selbst, sondern auch die Reflexionen über sie und ihren Formcharakter sind deshalb darauf angewiesen, sich auf Ränder, Schwellen und Zwischenräume zu verlagern. So erklärt sich die Bedeutung, die Briefe, Vorworte, Rezensionen usf. für die Verständigung über die Vorzüge und Grenzen solcher Formen gewinnen. Als Paratexte werden sie zur Plattform für die Kommentierung anderer Formen und Genres. Als Produkte eines Schreibens, deren Formen und Stile nur individuell zu kennzeichnen sind, charakterisieren sie sich aber auch selbst.
Evident ist das insbesondere bei der philosophischen Gedankenprosa und experimentellen Kurzprosa, die mit anspruchsvollen, emphatisch vertretenen Formkonzepten aufwartet. So schwer sich diese Texttypen begrifflich auf einen Nenner bringen lassen – Aphorismen sind als „Réflexions“ (La Rochefoucauld) oder „Pensées“ (Pascal) verzeichnet und in „Sudelbüchern“ (Lichtenberg) notiert, Feuilletons als „Spaziergänge“ und „Seifenblasen“ (Walser) betitelt –, so sehr muss sich ihr Selbstverständnis im Medium ihrer selbst erläutern: als Reflexion der kleinen Form in praxi. Friedrich Schlegels Fragmente sollen in ihrer Partikularität zugleich die Unverfügbarkeit des Ganzen ausstellen, das sie anvisieren. Die Erkundungen des Essays als Form brauchen bei Lukács, Bense und Adorno notwendig die Form des Essays. Auch viele Feuilletons handeln vom Feuilletonschreiben, wenngleich oft aus apologetischen Gründen: zur Abwehr des Verdachts der Banalität. „In der Aufzeichnung (so wie ich sie verstehe), komprimieren sich das Notare und das Formare“, notiert Roland Barthes über die von ihm geschätzte Kleinform der Notiz (Die Vorbereitung des Romans).
Weitere Konturen können diese Formbegriffe, die im Zuge solcher Diskussionen entwickelt und verteidigt werden, durch ihre theoriehistorische Einordnung gewinnen. Vor allem ist dabei herauszuarbeiten, von welchen traditionellen und gegenwärtig favorisierten Formkonzepten sie sich absetzen. Daneben muss aber auch gezielter geprüft werden, welche Paradigmenrolle die Lyrik für die Profilierung nachrhetorischer Formbegriffe behält – und in Autor-Poetiken auch neu gewinnt.
Theorieprogramme des 20. Jahrhunderts. An den jüngeren Theorieprogrammen fällt die Regelmäßigkeit auf, mit der sie sich auch vormodernen Kleinformen zuwandten. Prononcierter gerieten die Strukturen dieser Kleinformen in den Blick, als die Literaturtheorie der 1960er Jahre Linguistik und Poetik miteinander engführte. In der Folge des linguistic turn verlagerte sich das Interesse von der Hermeneutik individueller Kreationen auf typische Erzählgrammatiken, die zugleich die Grundlage schufen, um den Literaturbegriff zu erweitern und auf die ‚Texte‘ und Formenrepertoire der Massenkultur auszudehnen. Den Anstoß dazu gaben Formalisten und Strukturalisten, die Volksmärchen, Mythen und Bibellegenden minutiös sezierten. Deren Ergebnisse wurden durch eine umfassende Kultursemiotik aufgenommen, an die inzwischen narratologische Makromodelle anknüpfen.
Untersucht wurden „einfache Formen“ – darunter wiederum Märchen und Mythe – aber zuvor schon bei André Jolles, der sie 1930 ins Zentrum einer Morphologie auf anthropologischer Basis stellte. Wie seit dem 18. Jahrhundert häufig zu beobachten, kreuzt sich die Literaturtheorie hier mit der Geschichte anderer Humanwissenschaften, die für die Begriffsbildung Konzepte anbieten, von der Literaturtheorie im Gegenzug aber auch mit deren Hypothesen über ,den‘ Menschen, seine Natur- und Kulturhistorie beliefert werden. Das lässt es lohnenswert erscheinen, speziell die einfachen Kleinformen als Leitfossilien einer Wissenschaftsgeschichte der Literaturwissenschaft ernst zu nehmen, die aufklärt, welche Form-Konjunkturen und -Theorien sich hier durch die Koevolution von Volkskunde, Ethnologie und Anthropologie entwickeln. Außerdem sind Theorierevivals zu verfolgen. André Jolles’ Einfache Formen etwa wurde 2017 erstmals ins Englische übersetzt und von Fredric Jameson mit einem Vorwort versehen, das die Parallelen zu formalistischen Ansätzen hervorhebt, um das Buch damit an US-amerikanische Debatten zum „New Formalism“ anschlussfähig zu machen.
Eigene Studien verdienen schließlich die theoretisch-programmatischen Reflexionen kleiner Formen, die von Nietzsches Perspektivismus – als Hintergrund seiner Aphoristik – und Musils Essayismus bis hin zu gegenwärtigen Poetiken des Kleinen reichen. Hier ist etwa an das Konzept der „kleinen Literatur“ zu denken, das nach wie vor eine hohe politische Strahlkraft besitzt. Aus Kafkas Notizbüchern entlehnt, haben Gilles Deleuze und Félix Guattari den Term in den 1970er Jahren auf Idiome aller Art bezogen, die „minoritär“ sind, sofern sie von einer hegemonialen Form abweichen und mit dem Stigma des Minderen behaftet bleiben. In jüngeren Globalisierungsdebatten ist das auf (National-)Literaturen gemünzt worden, die keine internationale Marktmacht besitzen. Theoriepolitisch motivierte das Konzept aber auch einen minoritären Publikationstypus, der zur Formulierung dissidenter Positionen einlud: kleine Bücher; Separatdrucke von Aufsätzen, Einzelvorlesungen und öffentlichen Interviews; Bände mit rhizomatischem Aufbau, in denen „tausend Plateaus“ miteinander kommunizieren. Man kann darin Remediationen des Essays als Theorieform erkennen, die sich strengen Systemidealen entzieht. Schreibweisen des Zeitalters digitaler Vernetzungen, mit denen sich zugleich bestimmte online-Foren profilieren – gerade von Theorieverlagen und Zeitschriften mit ambitionierten Programmen der Gegenwartsreflexion –, können sich hier problemlos antizipiert sehen.
Research Program
Research Concept
Why Small Forms?
Complaints about the “flood” of news, information, and novelties demanding our attention have been notorious since, at the latest, the Early Modern Period. In the wake of contemporary medial advances in mobility and digital networking possibilities, they have become even more timely. To the degree that the resources of social attention have become scarcer and the interests of individuals more volatile, the pressure has increased to counter the abundance of what can be known with an efficient organization of perceptual worlds and to both recognize and adeptly use new spaces for creative play.
For this reason, small forms of writing and note-taking are appealing that help with the bookkeeping of observations and ideas, the communication of knowledge, and the steering of curiosity, and that at the same time ease our handling of constraints of time and space. Such text types as sketches, abstracts, notes, protocols, excerpts, essays, articles, and glosses can make a case for the advantages of the compact, the condensed, the quickly surveyed, but they can also reveal the provisional, the ephemeral, and the need for supplementation of what has been noted and can, in this way, suggest that they are both trustworthy guarantors of communication routines and disturbances, sources of productive irritation. Despite the elementary meaning that they hold for their use in research and teaching, art and public media, the genesis and evolution of the spectrum of their forms has up to now only been studied selectively.
The research training group will study the literary and epistemic history of such forms in historical outline, from antiquity to the present. Its systematic focus is on the praxis fields of literature, science, and popular culture, and it analyzes which small forms of writing and representation have established themselves within these fields, how with their help processes of communication are controlled, reflected upon, criticized, and channeled in specific media. Furthermore, the group investigates the dynamic exchange of small forms between these fields: the interactions that are both facilitated and obstructed by the history of their separation.
The research training group brings together scholars from a variety of fields: from English, German, Romance, and Slavic languages and literature, as well as from classics, cultural studies, media studies, history of science, and practical theology.
The Concept of the “Small Form”
The term “small form” is elastic and underdetermined, but it was already introduced into literary studies a while ago. Within the history of concepts, the term can be traced back to the end of the nineteenth century. Back then it referred primarily to the manifold varieties of short prose that were specially developed in the feuilleton section of print media, in the optically separated marginal zone in the bottom third of the newspaper page: its style could be sketchy, impressionistic and ephemeral in some cases; in others it could be lyrically dense, conceptually concentrated, and allegorical.
Meanwhile, the term has broadened and refers to some of the shortest of forms, such as the proverb and the joke, as well as small narrative genres – for instance, the short story. Hence, on the one hand, the field of “small forms” overlaps with that of “simple forms” as defined by André Jolles. On the other hand, useful didactic forms, such as the exemplum or the fable, also fall under this rubric; they were as indispensible for ancient rhetorical instruction as they were for sermons in Christian homiletics, or later for the rational education of enlighteners in the eighteenth century. Pithy forms of reflection with the character of a tenet, aphorism, or maxim derived from the same tradition of rhetorical topoi, which initially were compiled as instructive dicta before being extended to thoughts, inspirations, and ideas of all types that found their way into notebooks and diaries through a practice of private bookkeeping that was regular and minute. As a result of this praxis, conventional forms of text types that arose from ancient medicine, such as the aphorism, transformed in the seventeenth century. But they also led to a wave of new genres such as the essay, whose formal openness later had a radiating effect on feuilleton prose.
It is widely accepted that the spectrum of these small forms has diversified considerably in modern times and is predominantly shaped by the varieties of short prose that emphasize their modernity without denying their origin in older traditions. There is also a consensus that the disparateness of the field cannot easily be diminished by rigidly defining exclusionary criteria to narrow the aspects of form that are of interest here to questions of genre – and certainly not to mere literary genre. To be sure, genres may presuppose conventions of form, but not every form solidifies into a genre, and what is special about the small forms in which the research training group is interested is that they wander among different genres. This mobility of genre is linked to the circumstance that the “smallness” of forms can only be determined relationally from the outset: in interaction with larger complexes. Small forms emerge as abbreviations through selection and condensation; through their particularity, however, they simultaneously stimulate supplementations, can be recombined and amplified, and can in this way bring themselves to the fore in totally different ways.
The research training group’s approach accounts for this by refraining from a compulsory unification of terminology and placing the accent on a praxeological view towards small forms as products and motors of processes of communication and circulation. In lieu of fixed traits, the focus thereby lies on the dynamics that unfold in respective contexts of use.
Research Approach: Aesthetics and Pragmatics of Small Forms
The research training group’s goal is to clarify the functions and achievements of these forms in epistemic, school, educational, journalistic, and literary contexts of praxis. It is guided by the claim that small forms are actively engaged in the acquisition of knowledge, the transmission of experiences, and the steering of curiosity, as well as themselves formed by the corresponding procedures and involved media.
In our wide-ranging exploration of the field of study, we will draw upon concepts of form that have been developed and refined in the group’s previous work. We have tried to bring these concepts into sharper relief by relating them productively to contemporary theoretical models while specifying them by consistently following a praxeological approach. Accordingly, we treat ‘smallness’ not as a substantial property of the forms we examine, but as a topical circumstance and temporary disposition that invites such potential changes as supplementation, recombination, and expansion rather than excluding them. It simultaneously assumes a dynamic understanding of form, which accounts not only for economic pressures to save time and space, but also for the ecological factors of particular textual and media environments as situational variables. A given small form may, in being adapted to such environments, develop advantages or resistances that did not emerge in previous applications – while, in doing so, forging connections with other forms.
The concept of form favoured here is also dynamic in that – unlike traditional descriptors of genre in the terminology of literary studies – it considers forms attaining and sustaining autonomy as a possibility, but not as an absolute necessity for their regeneration qua form. For all their typological variety, the small forms already examined in individual studies by the group’s members – notes, excerpts, essays, lists, telegrams, case histories, courtroom reports, feuilletons, episodic stories etc. – are united by their appearance both as small forms of text and as small forms within larger structures, as particular elements of serial or collective works, and derive their attractiveness to users from the very mobility thus gained.
With a view to the three praxis fields of literature, scholarship, and popular culture, the overarching research questions of the research training group are:
- Which small forms of narration, argumentation, and representation could have and still might establish themselves within these fields, and how are processes of communication and negotiation steered, reflected upon, criticized, and channeled in specific medial ways?
- Which relationships of exchange can be observed between the fields? Which interactions are facilitated and which are prevented in the course of the history of their separation?
- Which parameters determine the interdependency of small forms, contexts of usage, and the production of knowledge?
New emphases in the second funding stage
1. Forms and formats
While our previous discussions foregrounded the economy of small forms and the aesthetic peculiarities associated with it, the intention is now to shift the focus to the ecological environments in which small forms are cultivated. Particular attention will be paid to the reciprocal interaction between forms and formats, specifically the manner in which small forms are ‘in-formed’ by the material circumstances of the media in which they appear and are distributed. Raising questions of format offers productive opportunities for connecting with contemporary debates in international media studies, notably research into the history of books and the press, which are able to contribute further considerations regarding the materiality of form.
As a technical term, “format” was long the preserve of the printing trade and referred to the size to which paper was cut and of the resulting books. Later, art historians such as Jacob Burckhardt began to think about horizontal and vertical formats, about round, oval, and rectangular pictures and their appropriateness for particular subjects as well as their suitability for dedicated exhibition spaces. These analogue visual media have since been complemented by a number of digital media whose formats are structured in such a way as to be legible as material traces of the media-industrial environments surrounding them. Recent elaborations of the concept of format take this development into account.
Book and newspaper history has responded to such research by re-examining the production and distribution of texts with regard to the pre-formatting of the material used for writing and printing. This has brought renewed attention to loose leaves, notebooks, fascicles, and autographs of the kind that circulate, often cut up, among the admirers of dead writers. The form of the book itself combines very different parts – tables, chapters, titles, indices – which each come with histories of their own and whose relation with the ‘whole’ of a particular volume is more fluid than it may seem (see research foci 1 and 2).
2. Connections and transitions between poetry and prose
Once we consider the proportions of paper and screen formats, as well as the necessary compression of data that media formats impose of recordings, we must also consider the relevance of quantitative factors, which so far have played only a subordinate part in most concepts of form with any claim to academic respectability. The extant scholarship on small forms is likewise in the habit of stressing that, in order to specify the particularities of smallness, attention must go beyond quantitative criteria of brevity and instead give due consideration to such qualitative aspects as concentration, compression, formality, pithiness, fleetingness, etc.
To introduce numerical measurements as determinant criteria of form was, at any rate in the study of literature, long restricted to the field of verse, in which the very word rîm – the old Norse root of both the English rhyme and the German Reim, which also denotes an entire (rhyming) verse – is associated with counting and serialisation. Such verse forms as the sonnet or the haiku, with their fixed number of lines or syllables, lend themselves to being expressed in formulas, and it is to this easily universalized poetic algorithm that they owe a good part of their international appeal. In contrast to such notable examples of short verse forms whose history may be traced to the Middle Ages, modern and especially avant-garde poets find their models for experimenting with the compression of language above all in the innovations of the contemporary public sphere and its media – in press headlines, in advertising slogans, or in the omission of words typical of telegrams. In that sphere, they also become aware of how exploiting the materiality of signs to the full by means of typographical design contributes to what Roman Jakobson called the “poetical function” of language outside of poetry gaining enormously in visual dominance.
With the spread of mobile phones and messaging apps, which encourage the quick exchange of messages and images by means of imposing arbitrary character counts, such constraints and limitations on language have, in view of contested resources of time and attention, found their way into many people’s habits of everyday communication. This in turn has contributed to making public correspondence more informal and formless, and in every respect less restrained. The multi-media capacity of the smartphone not only lowers the barrier between poetry and prose, but also the boundaries separating writing and speaking, reading and listening, showing and telling. It transforms messages into performative speech acts simply by transmitting them and in doing so encourages their writers to stage their words’ performance and indeed themselves.
The creativity of laypeople in fusing everyday communication, entertainment, and self-marketing is matched that of artists. North and South American narrative literature in particular has seen the growth of an entire universe of fiction in extremely small forms, with authors challenging each other to work within the smallest of word counts. Poetry can be seen to flourish with equal vigour. At poetry slams, in which authors of texts in prose and verse are subject to the same time limits, the individual voice as amplified by the microphone claims, as it were, the limelight. Meanwhile, social media channels are full of tender verses simpler even than those of the poetry slammers and reaching millions of fans. “Simple forms” may thus be seen to refer not only to the indestructible residues of the archaic, but also to very recent forms operating with deliberate simplification and while making a point of breaking with tradition or academic convention. In so doing, they encourage what Rita Felski has called “post-critical” attitudes (see research foci 2, 3, and 4).
3. Small forms as actors within collectives
The enormous success currently encountered by poetry in pop culture can be explained not least in terms of the immense social energy its circulation generates. Shared passions produce communities of fans who experience their mutual connectedness at readings and slams, both by way of their intense physical co-presence and by the affective resonance of the event. Internet platforms that market themselves to their users as social media and promise cooperativity in forging multiple ways of relating to the world offer these communities a means of expanding in virtual space. They also permit interactions between people who have never met before that go beyond sharing and creating posts.
Whereas communities of the conventional type are distinguished by their self-definition as stable social groups with a shared local or cultural identity or with shared goals and values – examples include religious groups as well as the “scientific community” – the social formations that emerge with the aid of digital networking technologies are more disparate and cannot be fully comprehended within such traditional categories as “community” or “society”. In recent years, sociology and cultural theory have directed particular attention towards collectives distinguished by their heterogeneity. Though they emerge from a “society of singularities”, in Andreas Reckwitz’s phrase, and may dissolve as unpredictably as they emerge, they may nonetheless form powerful units for action. Precursors of such collectives may be found in social movements that march in in streets and squares and in which mass mobilization takes place by means of rhythmically distinctive songs as well as by chanted slogans.
Small forms thus emerge as media of a culture of political debate that leaves the institutionally tended space in order critically to interrogate rhetorics of power and to express “disagreement” (mésentente, in the sense developed by Jacques Rancière) in a manner that dovetails with claims to transform the public sphere of speech and action. This casts further light onto the performative potential of small forms – particularly onto their importance for creating social formations in the analogue and digital worlds, and onto the agency which they unfold when they are circulated and ‘shared’ on a large scale for the purposes of creating communities or fomenting polarization (see research foci 1 and 3).
Main Areas of Research
Routines of Usage – Teaching, Learning, and Researching in Small Forms
The group’s previous studies have confirmed that rhetorical techniques have served as a crucial motor of innovation for the differentiation of small prose forms in particular. Yet how such handed-down items of knowledge could be both preserved and dissolved in this process and to what extent newly emergent forms gave rise to new rules and new ritual usages in entire groups’ habits of communication and cooperation remains to be further examined. Based on the themes and questions forming the existing focus of inquiry, the following topics would seem to call for further analysis:
Small Forms as “Little Tools of Knowledge” I: Epistemological Functions
Teaching lessons/learning lessons. Classical rhetoric considered didaxis – with regard to imparting both the teacher’s own techniques and lessons in morals and practical wisdom in speech – to be a matter of adroitly deployed historical knowledge. Historia, cast as life’s teacher (historia magistra vitae), was long preferred over literature (fabula) for containing an archive of confirmed precedents. Such exemplars, in the traditional view, were held to be more persuasive than fictitious narratives.
A broader set of challenges when compared to political orators and academic teachers was faced by those who set out to proclaim the word of God. The Scriptures revealed not only the story of a miraculous salvation playing out within the world, but also the glad tidings of a life after death of which the world was to be told. Such Italian bishops of late antiquity as Ambrose of Milan fulfilled this task with an exceptional degree of rhetorical and philosophical brilliance and were thereby able to win over such exacting intellectuals as Augustine to Christianity. Later churchmen did well to calibrate theirs moral sermons to a more diverse audience, composed largely of men and women familiar with neither Latin nor Scripture. In the Middle Ages, the pulpit provided as much schooling as large sections of the population could ever expect, and the responsibility to ‘teach’ fell to the clergy in a broad sense. Today’s preachers are concerned above all that churchgoers, who in their personal and professional lives are surrounded by an array of sophisticated media of information and entertainment, should not be bored by dreary monologues. Accordingly, homiletics has for some time now been propagating a “change in coalition […] from communication science to aesthetics” (Gerhard Marcel Martin). Preachers were now advised to take their cues from modern narrative fiction and to design sermons as open works of art, in which ambiguities and lacunae were to elicit creative participation on the part of the congregation.
Encouraging autonomous learning looks back on a longer pedagogical tradition than many would imagine. As early as the Middle Ages, canny university instructors were using games and learning cards in order to break down the complex material in elementary legal training. One consequence was that the requirements of teaching came to take precedence over faithfulness to the work of reference. What was worth knowing became synonymous with what leant itself to being taught. In present-day academic contexts, an analogous dilemma can be identified in the conflicting objectives of research and teaching. Niklas Luhmann pointed out that research had to justify itself with regard to “a marked absence of knowledge, itself capable of being distinguished and identified”, whereas teaching consists of passing on established knowledge. The market now offers beginners a variety of handbooks and introductions to ease them along their first steps. For an exploration of the epistemology of examples and their persistence or afterlife beyond collections of rhetorical tools, such material constitutes an object of study hitherto only sporadically considered by historians of knowledge.
Making Records. Rhetoric has also been formative in controlling micro-procedures within the store of ideas. As imparted by manuals, the techniques of note-taking and organizing not only serve to stabilize a long-lived culture of making excepts, but also play a crucial part in processes of searching, drafting, and inventing. They also contribute to coupling note-taking with regular exercises and rituals of observation. The research group will therefore continue to study historically changing practices of note-taking and annotation, which are also connected to the birth of the essay. We also welcome contributions on the subjects of forms (in the sense of standardised blank documents) that provide the paper technology necessary for the habitualization of modes of perception and styles of thinking. The same applies to interviews and questionnaires used in generating empirical data.
To a greater extent than has hitherto been the case, we also hope to focus on small forms that lend themselves to cooperation between authors or which publicize their own character and that of the writing they contain as preliminary – media, that is, whose informality is formalized and which are designed to generate follow-up work as they circulate within a limited sphere. Examples may be found among the many species of so-called ‘grey’ literature: reports, proceedings, newsletters, or working papers not held to the usual standards of publication – by their smaller circulation, the lack of peer review, limited distribution in crudely stapled form to subscribers to a mailing list and its digital equivalents – but which may nonetheless, though incomplete, establish a project’s reputation in the field.
Creating Facts. In the seventeenth century such scholarly journals as the Philosophical Transactions of the Royal Society of London, the Journal des Sçavants, and the Miscellanea Curiosa Medico-Physica were pathbreaking not only in introducing the short scholarly article but also, by sporting this small form, also created the material possibility for the individual observation and detailed description of facts. The preparation of facts in the late seventeenth century, in the course of a shift in scientific curiosity from the miraculous and monstrous to the inconspicuous and usual, is connected with a pronounced rhetoric of the avoidance of rhetoric. When precision, in correspondence with the Latin literal sense of praecisio, dictates the “truncation” of the superfluous, this ethos supplies not only a justification for the straightforwardness of prose (from prorsus = straight), but also only allows an artefactum to be a factum when it reveals its naked core through reduction to the succinct in a way that enables it to represent itself as an essence and opaque remainder that contains within itself a potential to unfold that has to be explained. It is in the elicitation of such potential that the ratio of sketches and notes resides that oscillate between hunch and observation, mind game and nomothetic statement, factography and epigrammatics, and in the diversity of their small forms participate in the pluralization of norms that ground rationalities of research. “True” and “false” are by no means the only criteria of judgment. For epistemic processes, it is just as important to gauge the “fecundities,” “plausibilities,” and “connectibilities” of the assumptions employed and the paths taken.
There is a pressing need for the continued exploration of forms and processes of the scholarly and scientific production of facts not least on account of controversies over the viability of conclusions and predictions based upon such facts. These debates have attracted sometime aggressive interventions from decision-makers in politics and business, who wish to abuse interdisciplinary controversies as fig-leaves for their own purposes. Such interested parties reject demands to act or to assume responsibility with reference to ‘facts’ that are supposedly open to interpretation and thus provide no grounds for appeals or claims. Meanwhile, the erection of ‘fact fetishes’ – rhetorically manufactured faitiches (Bruno Latour) which, as fictions of incontrovertible certainty, are supposed to act as common denominator for all facts and to discredit any other knowledge as ill-founded faith – with high visibility in the media is currently encouraging the spread of what Robert Proctor has called agnotology, which may find expression in hyperbolic scepticism or overt anti-science sentiment.
Small Forms as “Little Tools of Knowledge” II: Exemplary Fields of Praxis
Praxeology of the Humanities, Human and Social Sciences. While research of this type is already quite differentiated within the fields outlined here will link up with research that has already proved highly productive, for instance into processes of note-taking or the many kinds of case study, comparable studies on the humanities and social science have only recently undergone a marked increase. Small forms such as reviews, letters, pamphlets, mottoes, inaugural addresses, and letters of reference continue to provide rich and in many cases still unexplored material for the examination and deeper understanding of such phenomena as the formation, fracturing, and dissolution of (scholarly) networks, schools, and currents.
Another field of enquiry still in its infancy addresses the emergence of forms as it encouraged by publication formats: books, magazines, newspapers, online media. Another field in its own right that can be observed here is that of specialist discourses that develop outside academia, organize themselves around magazines and online platforms, and are supported by actors who are both fans and observers. A particularly complex picture emerges with regard to pop culture, whose leading thinkers maintain both an interest in theory and a wary distance from the mainstream. They use magazine articles as a means of cultivating creative forms of reflection aimed at shoring up – both intellectually and performatively – the boundary between advanced pop and commercialised mass culture. This, in turn, is bound to attract academics with an interest in youth and subculture, and who may hope to forge alliances here.
Didactic and pedagogical initiations. Breaking down knowledge for the purpose of instructing novices is a fundamental principle in all spheres of culture that are institutionally organized. Schools have for time now done away with textbooks as the primary medium of instruction, instead using worksheets to concentrate on particular stages of learning. Various kind of propaedeutic media may be found at the university level, e.g. companions which, as modern descendants of the mediaeval vademecum, offer compact discussions of the state of the scholarship in a field. They are to be distinguished from readers, which provided annotated selections of material for studies lacking close disciplinary ties or long traditions of research. Specialists working in the field of didactics have observed that certain small forms are likely to do more harm than good from a pedagogical viewpoint. Accordingly, “didactic reduction” was discarded as a means of imparting abstract subject matter and replaced by a new focus on allowing students to grow by solving problems close to everyday life. This, in turn, enhanced the relevance of such kinds of text as the essay, which trains students in basic narrative and argumentative skills, as well as in adapting style to occasion.
Popularization of Knowledge and Science. Small forms may help to lower barriers to access and to turn specialist knowledge into common knowledge. In the book and periodicals market, illustrated magazines took an early role in leading such dynamics of popularization This explains the popularity, in the nineteenth century, of tableaus that adapted aesthetics of genre painting to short prose. In the form of “nature paintings” or “geological pictures,” it introduced curious readers to geography and botany and made it easy for folklorists to capture regional mores and customs in cultural images. At the moment there is a boom of variations that combine little ritual tests with athletic completion. Within this framework, the principle of prodesse aut delectare can still legitimate forms of the short performance such as the science-slam in which presenters – mostly aspiring young scholars – prove their competency and quality as entertainers under strict time constraints. Today, lecture performances by authors and artists also feature in the programmes of academic conferences, where they fulfil a dual function of contributing to the topic at hand and providing entertainment.
Projects concerned with questions of the type sketched here will have to take into account the results of research on the “materiality of communication,” on cultural techniques such as speaking, writing, and reading as well as of counting (with regard to pages, chapters, lines, verses, volumes, foot- and endnotes, columns, lists, etc.) and of bookkeeping (journal- or house book-keeping). Also to be considered are upheavals in media history that accompany the proliferation of analog, electronic, and digital media technologies, and finally the historical social and educational conditions of access to institutions of learning and instructional media.
Activities of Collection – Small Forms in Larger Corpora
The research group’s second principal focus is on the practices and media of collecting, by which small forms are administered, secured, and prepared for the historical record. Our working hypothesis hold that, the smaller the form, the less it will bear consideration in the singular, depending instead on being located within collections or other larger forms. This also means that we cannot dispense with examining the contexts of media, genre, and editorial policy within which such forms are gathered, transmitted, and rearranged, themselves emerging as the germ of further generic evolution in the process.
An approach that has proved rewarding has been to begin by considering selected collections that situate small forms within larger works or other overarching paradigmatic entities, thereby integrating them into a variety of relations between part and whole. In the second funding stage, the typological spectrum of such relations is to expanded by broadening our examination of poetry to encompass collections whose relationships between part and whole are especially intricate. As an exemplar of this type, we may cite volumes of verse known to scholars as “cycles”, a term that conveys a particular aesthetic valuation of a work-like composition by the author’s hand. Yet a culture of printing that accounts for the verse structure of poems by adapting its material design accordingly – in typography, spacing, and the positioning of page breaks – must not, historically speaking, be taken for granted. With a view to future research, this makes it seem worthwhile to look for indications of the emergence and evolution of forms in the adaptations made by the media forms in which they circulate and, conversely, to trace the concessions made by small forms to the changing format requirements of these very media.
Small Forms as Objects of a Collection I: Functions of Storing and Ordering
Accumulating a Wealth of Knowledge. Archives, libraries and cabinets of curiosities have in recent years increasingly become more an area of interest for researchers, and studies have shown in detail how storage technologies (from the filing cabinet to registries, filing systems and notecard boxes, to digital copies and electronic databases) at the same time participate in the (re)production of knowledge and in the stimulation of literary creativity. The research training group can build on this research. Posing a particular challenge are the early-modern thesauri, analecta, commonplace books, and Aeraria poetica, which literary studies had avoided for some time but is now paying more attention to. These are collections of parables, sayings, adages, and maxims stored as “treasure troves” of rhetorical topoi for the inventio. Typologically, these commonplaces occupy the middle between narrowly defined generic forms of compilation literature on the one hand and the cross-section of collections of extracts on the other hand, in which the most disparate pieces are combined according to the principle of entertaining variety: in the sense of the Roman, Aulus Gellius, who characterized his Noctes Atticae – the paradigm of such compilation in late antiquity – as showcasing “varia et miscella et quasi confusanea doctrina.”
Because the enormous range of this mixed literature is only beginning to be studied – also in its continuity with medieval manuscript collections and with current thesauri on the internet – the research training group can contribute in a large degree to the indexing of these materials. Besides the distinction between homogeneous and “colorfully” stored compilations, it would be advisable to separate different types of small forms. We would have to distinguish such forms that already enter into collections as small independent genres – proverbs, maxims, riddles, legal formulas, legends – from others that only arise through abbreviations, isolation, and selectively being cited in the first place: as exempla, Apophthegmata, excerpts, or “digestibly” portioned passages in anthologies in the style of Reader’s Digest or Beauties of…
As far as poetry is concerned, historical interest – and specifically the history of knowledge and of scholarship – is likely to find such collections to be particularly illuminating in which poems are held up as exemplary specimens of timeless ideals of perfection or as representative of styles or movements. The same applies to collections of songs that offer insights into the oral culture of faraway indigenous peoples while being unthinkable except against the backdrop of European colonial expansion. In the context of modernity, the forms of ‘primitivism’ they discovered inspired both bold artistic experiments critical of modernity and pioneering scholarly works.
Another area so far to have been explored only in isolated instances concerns the effects that the transatlantic export of books and periodicals in the course of colonisation had on the globalization of small genres and their transformation within other literatures – and their survival within postcolonial (market) constellations. Such migrations may be observed in the aphorisms and sayings of the kind that formed a popular genre in the former colonies of France, Spain, and Portugal, but underwent distinctive local and indigenous adaptations.
Differentiating Types of Knowledge. Furthermore, we seek to study how these corpora of collections contribute to a differentiation of types of knowledge – according to lore, rules of thumb, formulae for success, canonical, heretical, or esoteric knowledge, open and intimate secrets. This depends on the extent to which such knowledge shall be kept private or made public. Collections of anecdotes, for instance, feed on the fact that they spread stories which historians consider too thorny or invalid. They are based on the historeme, understood as the “smallest minimal unit of the historiographical fact” (Joel Fineman). On the other hand, since the time of humanism, commentaries have led to the proliferation of marginalia of other types – in the form of paralipomena, excursus, quaestiones – in which individual truisms can provide hooks for an eclectic mix of interesting things to know of the most diverse provenance. Finally, we must remember collections whose purpose is to slander or defame an opponent. Examples include the collections of Catholic legends and miracle tales of the kind published by Luther and other Reformation figures, who added critical commentary and gave them such titles as Lügende (a portmanteau of the German for lie and legend).
Enabling the Acquisition of Knowledge. Because such compilations are in both competition and alliance with encyclopedias and novels, as well as with newspapers and journals – this ambiguity is implicit in the very term magazine, which originally denoted a repository or store; online archives like JSTOR have recently brought this meaning back to the fore – we also have to clarify in which ways such compilations serve not only the selective interest of their authors and editors but also those of their readerships. This pertains, on the one hand, to the habits of selection, reading and not-reading that is attended to by the text economy and material design of compilations and magazines (typography, image-text relations, layout, paper and book formats) and have only recently come into the focus of a conceptual history of media use. Another factor to consider is how reading is structured in time. Then there is the alternation between phases of skimming and skipping, which anthologies along the lines of Beauties of … inculcate in their readers by interspersing passages quoted verbatim with summaries of others.
Additionally to be considered, on the other hand, are the social rituals of conversation and oral channels of “chatter” around which such thesauri are oriented. In baroque compilations such as “Conférences” (Théophraste Renaudot) or “conversation games” (Georg Philipp Harsdörffer), for example, encyclopedic knowledge is playfully communicated within the framework of a staged conversation that is supposed to be as witty as it is “amusing” and promote the conversation culture of readers through its conversation topics.
A direct path leads from them to both the apostrophized “Conversations-Lexica” of the eighteenth and nineteenth centuries which aim to deliver a “concise handheld dictionary for subject matter from the sciences and arts that arise in social conversation, with constant regard for the events of ancient and modern times” (subtitle of the Brockhaus Dictionary of 1809) as well as to future collections of recitable knowledge by contemporaries: Büchmann’s “Dictums” or Flaubert’s Dictionnaire des idées recues, in which dictums are relatively rare but the realistic novel is all the more exploited as an archive of bourgeois commonplaces. Furthermore, we can call to mind the “-ana”-literature in which the older miscellany survives as a residual playground for mavericks – preferably for professors and artists – and evidence of their intellectual distraction amasses, from which the rest of the world draws its anecdotes.
Small Forms as Collection Objects II: Paradigmatic Work Complexes
Reference Works. Among compilations, corpora which have acquired a reference function through their construction, their inclusions and exclusions, enjoy a special status. They have become constitutive for the maintenance of professions and arts as well as for the nurturing of disciplines. Without the Torah, the Bible, and the Koran there would be no theologies, without law codes no law, without compilations of examples no casuistry, without magazines of case studies or compilations of fairy tales, legends, and myths no experiential psychology and criminology, no ethnology, anthropology and psychoanalysis. As introductions into particular ‘arts’ – the arts of cooking or pharmacy, for instance, but also those of rhetoric and poetry – an analogous status may be claimed by recipe collections can lay claim to an analogous status fur instruction in the arts – for example, of cooking or medication, but also of speaking and creative writing – which put locally guarded practical knowledge into a nutshell of measurements and formulas, rules and to-do lists, in order to facilitate its controlled dissemination.
Tied to this acquisition of small forms as exempla, rules, cases, and so on, are editorial interventions and goal-oriented “purifications” that guarantee that the individual pieces selectively come to the fore as integral parts of an organized whole, as representative patterns, typical exemplars, replaceable samples, relics, or as unica. Such interventions also ensure that the collections are addressed either as closed and hence complete corpora or as open aggregates inviting continual accumulation. Selection, arrangement, and sequencing can, for their part, borrow from the model of other historical or contemporary collections and either produce or sunder links to tradition. We therefore need to inquire into the editorial and compositional principles of such reference works, into the formal paradigms for short prose that are thereby produced, and finally into their claims to authority and the ways in which they steer reception.
Future studies will have to pay greater attention to any coexistence that may be found between different editions distinguished by format, size, and appearance, by changes of scale in successive editions, and to changes in reception due to additional prefaces or notes, as well as to alterations made in the course of translation.
Collected Works. Small forms acquire another significance in the context of collections that account for life works, undertake character studies, or keep records of the development of subjects. The spectrum of such collections extends from encyclopedias which support the state such as the Biographia Britannica – an archive of compact representations of the curriculum vitae of “most eminent persons” meant to serve the writing of England’s national history – to short portraits like Brief Lives by John Aubrey, to diary notes, essays, and correspondences as small forms of an écriture de soi. They create space for introverted meditation as well as for flashes of wit and mood and spontaneous inspiration in a given “scene of writing” (Rüdiger Campe).
Worthy of study in this context are individual analyses of editorial projects that bring together written work by individuals under the guidance of a calculated politics of the work. The nineteenth century saw an enormous spread of the assortment of collected works, headed by the complete editions of individual authors. That such editions not only swell up under all sorts of small writings but also come up with discarded variants as well as other fragments from a writer’s papers – often invested with an aura by facsimiles of the handwriting – creates for readers both an easy appreciation for such records and a hermeneutic duty. Another possible way to bring together the scattered materials – in the sense of scattered, smaller publications – available to authors is through narrative inclusion in prose works of a second order. We find this taking place in novella collections in the style of the Decameron that in the nineteenth century frequently arise through the secondary usage of narratives, now inserted into framework narratives that retrospectively motivate their being narrated, namely through conversation games.
Yet such constructions remain fragile and do not fully incorporate the disparateness of the short stories in the master narrative. The extent to which small forms provide opportunities to counter grands récits with skepticism and to refuse being subsumed is not only an issue in literature but also in historiography since at least the twentieth century. Approaches such as microstoria become then an expression of epistemological scruples: they make entire monographs out of particular case studies which are only worth a footnote to others. The pendant to this in new historicism is the programmatic recourse to anecdotes; in the social historiography of literature – which thereby also announces a need for scholarly reform – it is the renunciation of individual monographs by solitary specialists in favor of edited volumes with shared authorship.
Series – Albums – Networks. To be contrasted with such compilations are the principles of serial linkage that are especially formative for popular media and epistemic cultures. Subscribing to small formats – which circulate in dime novels and paperbacks for a reason – they develop a plethora of procedures in order to spark interest among their audience in their continuations, which do not have to be sequels but can also be guaranteed by series, remakes, or transmedial adaptations. Albums also enjoy a similar popularity. As books in the conjunctive, they provide leeway for provisional and reversible combinations of small forms and images that do not necessarily have to give rise to a work.
With their order of return, they stimulate such albums in miniature that the World Wide Web implements on a large scale by enabling on an elaborate technological basis infinite combinational possibilities of posts. Such neo-encyclopaedic structures encourage ‘users’ to ‘cut & paste’, but also invite them – within the confines set by programs and apps – to collaborate. Meanwhile, book publishers and digital archives such as Project MUSE and JSTOR find themselves faced with new ways of ‘unbinding’ works traditionally published in hard or soft covers and marketing individual chapters or articles. The reception of intellectual content may thus occur in complete isolation from the publishing context in which it originally appeared. What remains in the web of the physical book is a virtual ‘account’, in which new entries are logged in the form of a list.
The utilization of web-based platforms and social media channels for purposes of pop culture is facilitated by the running count of views and likes. This allows followers to track, by means of rankings, what other users are enjoying at this moment, thereby allowing them to form coalitions of interest and even to make new stars. For art forms of the early twentieth-century avantgarde, this kind of networking was provided by non-commercial ‘little’ magazines, which served to spread various aesthetics of modernism beyond European and American metropolises. As Eric Bulson observed: “No little magazines, no modernism: it’s as simple as that.” They garnered attention not least by the use of innovative layouts and eye-catching typography.
Programs/ Schemes for the Timeliness of Small Forms
The third principal focus of the research group’s work will continue to be placed on the aesthetic, media-technological, and economic scopes of which small forms take advantage in order to respond to topical demands. The overarching question for research is thus to investigate the functionality and attractiveness of such forms for the present’s self-information and self-reflection. We shall examine which small forms are particularly responsive to the demand of being up-to-date, as it raised by successive waves of innovation in the media, and how they contribute to changing the categories of what is considered to be worth knowing. We are also interested in the aesthetic processes by which they adapt to or resist mounting time pressure and, in so doing, remain competitive in the race for relevance with other small forms and media.
In its future work, the research group is particularly interested in examining how small forms of prose and verse negotiate their distinction from one another. It remains to be established under what strictures of artistic, economic, and media scarcity their boundaries become fluid. We hope that this will also further illuminate the contribution of small forms to modelling concepts of history, and the impulses they provide towards the differentiation or rejection of such concepts. Finally, we are interested in the capacity of small forms to mobilize – in the agency they develop as drivers for polarisation and gathering.
Small Forms as Time Probes I: Innovation Capacities
Differentiating Layers of Time.Small forms are considered major witnesses to, beneficiaries from, and pacesetters of a form of modernity among whose most salient features is acceleration – not least because the press, photography and the phonograph, telephones, radio, television, and most recently digital media have all added to a craving for immediacy. At the same time, this promotes an intensive reflection, predominant in philosophy, over the concept of prose, leading to new semantic determinations of the term. If before 1800 the term is still shaped by rhetoric – and in this context synonymous with the oratio soluta, i.e. metrically unbound speech – it subsequently becomes the common denominator of the “proper nature of modernity” (Friedrich Schlegel, Über das Studium der griechischen Poesie [On the Study of Greek Poetry]) and advances to the linchpin of diagnoses of the times, which note the contingency of present changes while connecting them to attributes of decline. These diagnoses provide provisional interpretative patterns using the wide-angle of philosophical history. Elevated to the epitome of modern relations, prose is either considered the flipside of a loss of stable orders or the result of historical processes of increased complexity that are explained by advances in rationalization, technicization, and scientification.
For poetry, these developments open up new areas in which it may renew itself and self-consciously break with tradition. On the one hand, the emphatic character of modern freedoms erodes the rhetorical conventions of old and provoke transgressive and heterodox appropriations or established repertoires of form. On the other hand, this liberation from old conventions also does away with the need to adhere to such binding devices as verse and rhyme. The aestheticization of formerly pragmatic and utilitarian forms and the reduction of the distance from prose – the purposeful profanization of the most hallowed traditions – stand for two complementary tendencies by which modern positions may take their bearings. In futurism, this takes the form of a fierce battle-cry directed against all ‘pastist’ tendencies, as F.T. Marinetti called them. He was not the last representative of a decidedly modern aesthetic to break taboos by a calculation incursion into sacred precincts. It is striking owe often, particularly in poetry, religious phrases are drawn from payers and hymns in order to subverted and perverted. Primitivism is a parallel tendency, and comparable developments may be observed in pop and is associated youth and sub-cultures.
It remains for analyses of exemplary cases to gain a closer understanding of how the small form of prose and poetry emerging from these conflicts deal with the difference between poetry and prose, and indeed make whether they treat this difference as something essential or nugatory a variable apt to be used as a signifier in order to cast oneself as up to date, avantgarde, anachronistic, or timeless.
The research training group will have to subject these grands récits of modernity to a re-reading due to the very fact that much research on modern short prose relies on them. For they do not allow us to account for non-synchronicities within the periods in question and continuities above and beyond epochal breaks. With a view to the empirical plenitude of modern short prose, we shall thus investigate what knowledge of their times these diverse forms transport insofar as they make their mark as being up to date, as avant-garde, anachronistic, or timeless. It is in these ways that they showcase their affinity or distance to the given standards of being current that are set by the publication frequency and transmission speed of the media of dissemination in which they appear.
Registering Trends. The boom in the many new small forms was set into motion in the fifteenth century by the printing press, which brought calendars and pamphlets en masse to the people in order to circulate and illustrate matters of seasonal relevance or daily news. Advancing to the epitome of small forms, however, were specifically those varieties of short prose that have been cultivated in newspapers and journals since the late eighteenth century. They begin with the fragments by romantics that, in their showcased provisionality model themselves on processes of becoming, and lead to “mere journalistic writing” (Zeitschriftstellerei) by authors who understand themselves as “movers of history” rather than as “writers of history” (Ludwig Börne, Briefe aus Paris [Letters from Paris]), and on to fleeting fashion reports, physiologies of Parisian social life, caricatures of contemporary politics, and metropolitan feuilletons. Alfred Polgar’s apology for the “small form,” which emphasized in 1926 that its “episodic brevity” is “appropriate to the tension and the requirements of the time” (Polgar, Orchester von oben [Orchestra from Above]), elevates the feuilleton miniature to the paradigmatic genre for all who are active, in Charles Baudelaire’s sense, as “painters of modern life.”
The depth to which large corpora of newspapers have now been digitized makes it easier to examine such feuilletons within the media environments of their original newspaper pages and to give a fuller account of their circulation histories, in which subsequent anthologies or even collected editions represent exceptions rather than the rule. This also enables us to trace how the form of the feuilleton relates to the conditions of their newspaper’s production, distribution, and reception, but also their interaction with the policies applicable to information on the rest of the page – e.g. by developing serial formats of their own. In contrast to such pragmatic aspects, awareness of the aesthetic appeal of small feuilleton prose as a principal attraction has long existed. Yet the proximity to literature it so often sought tended to attract largely derogatory remarks. Their newspaper work may have supplemented feuilletonwriters’ income, but it seldom enhanced their literary reputation.
For that reason alone we must also consider the gestures of distancing by which such hybrid forms of journalism and literature are relegated, if only rhetorically, to an inferior position within the newspaper. We may also find such distancing manoeuvres in narrative fiction, and performed by the authors themselves. A contrast may be drawn between small literary forms and large ones that make an obvious bid for contemporary relevance by borrowing formal elements from small media formats. This move suggests itself in the context of programmes of realism and objectivity as well as in avant-garde literature and political poetry. Evidence may also be found in pop literature, whose relationship with the feuilleton is refracted in multiple ways by the self-conscious disdain with which it is treated by the mainstream, of which bourgeois culture is such an eminent part.
Taking Note of News. The acceleration and facilitation of telecommunications entails an expansion of the spectrum of factography. In the daily bustle of journalism, the note acquires a new function. Recorded are not observations and thoughts, but incidents. The short communicational form guarantees a minimal distance between an event and a report, which allows the circulation not only of something new but of the “newest” something. The assurance of being current acquires a systematic dimension through updates at the point where the correlation of a small form and news defines what is information.
As news – and that distinguishes it from scientific fact – the journalistic fact is not retained for later use. It demands attention insofar as it “converts the infinitive of a still uncompleted present into the past participle of the factical and makes us aware of it in this provisionally definitive or definitively provisional form” (Juliane Vogel). “Facts” of the fait divers type – which not without reason are on the rise, as press agencies see to the rapid turnover of telegraphic reports from around the world on the news market – are a prime example of the smallest notes with which the newsworthy is extended to include the oddities of everyday life and the marvelous and the monstrous appear in the ordinary: in lotteries, fortunate rescues, accidents, swindles, or mysterious deaths. Under the rubric of “miscellany,” the press scoops up all types of colorful slivers of reality that represent themselves as naked facts, in the sense that they do not otherwise reveal anything and hence remain uncertain as to whether a story lurks behind them that might be worth digging up.
Small Forms as Time Probes II: Hot Spots of Managing Currentness
Novellas. Initially it was the novella that profited from the enormous growth of the market for facts. Distancing itself from the topical stockpiles of traditional historia, it nonetheless does not make use of the blank license for fiction and prefers discovery to fabrication. It takes up principles of the rhetorical inventio anew under different headings. Requiring more close analysis in synchronic and diachronic studies, however, are the ways in which novellas themselves defend the comprehensibility of their form, on the one hand by denying epic breadth and on the other hand by representing unheard of events in detail. We can observe, in turn, all kinds of adaptations of other small forms: from rhetorical formulas of the exemplum which, for example, are often used contre cœur whenever moral didactics serve as an alibi for a narration that would rather entertain than instruct a curious readership. We also encounter case studies that are used as rebuttals. As a source of “improbable veracities” (Heinrich von Kleist) that are positioned against the likelihood of history, the anecdote receives considerable credit. Novelllas just as avidly absorb idle chatter and spread the stories that circulate within it. Even old legends. If we do not wish to discredit that as regression or, conversely, take pride in the progressivity of narrative literature that proves its higher standard by “showcasing” the simplicity of oral forms, then we would need to closely study the complex contemporary news situations into which novellas intervene – not the least because they themselves reach their public via newspapers and journals.
Avant-Gardes. In the post-1900 avant-gardes, the laconic character of small factual prose finds a space in which it can resonate. It makes a point of proving that “brevity is modern” (Michael Gamper/Ruth Mayer). This claim is borne out by experimental ways of writing and minimalist aesthetics, in which prose and poetry largely assimilate one another, as they had already done in Baudelaire’s pathbreaking Petits poèmes en prose of 1857. This, in turn, adds to the enigmatic character of small forms. Textures emerge that bound on the incomprehensible and in which the banal appears bizarre and the outré seems ordinary. The microrrelatos of Spain and Latin America and the American forms of sudden fiction and flash fiction are among the more recent successors of such micro-narratives.
On the other hand, the aspiration to bring about a radical defamiliarization of reality, in order to uncover what is new, motivates collecting in the interest of the documental. Sergej Tret’jakov, for example, begins in revolutionary Russia to produce the most succinct “očerks” (sketches) in order to de-automate perception through rapid and unreflective writing. If at the same time DADA activists reach for the scissors, in order to generate the material for their collages out of newspaper scraps, they do so as malicious observers of the times, lurking behind techniques of cut and paste, in whose montages the rest of the world is supposed to see its own absurdity. A current form of pop-literature comes close to them, at least in procedure, which gathers up song snippets, advertising slogans, and brand names and creates novels as encyclopedias of quotes with the character of a signpost for a generation. New archivists are at work here, whose forms of labor can be regarded as updating older practices of excerption – although now the notations capture communications that take place “only just now” (Eckhard Schumacher).
Platform Internet. Nowadays, anyone who owns a smartphone is able to produce such feedback effects between the self and the present – by writing and reading, by audio-visual telecommunication – effortlessly, anytime and anywhere. In their capacity as ‘social media’, internet platforms counting many millions of users provide the infrastructure to host ‘posts’ of all descriptions, equalizing them as ‘information’ that circulates as freely and unconnectedly as nowhere else.
With reference to the basic democratic right of free speech, the US Supreme Court, as early as the late 1970s, removed legal boundaries thought to hamper, in Herbert Schiller’s words, the “free flow of commercial information”. A so-called Communications Decency Act, which came into force in 1996, relieves both of providers and users from the burden of responsibility for ‘information’ – text, images, video – produced by others that they circulate. Such free passes to anyone with an account to distribute content created the conditions for making opinion as such – free speech unfettered by the need for explanation and justification or by legal responsibility – was elevated to the general standard of any kind of ‘speech’ on the internet. Corporations such as Facebook take advantage of this licence to spread ‘information’ at such a scale – three million posts per minute on Facebook, six thousand tweets per second on Twitter – as to render impossible any attempt to check the conformity of such posts with legal norms or standards of civility. This has led such academics Evgeny Morozov to speak of a digital Reformation, a form of “digital Protestantism”, in which messages spread unimpeded by institutional gatekeepers. Rather than being filtered, interpreted, censored, and thus ‘distorted’, these messages reach the general public on the understanding that they may in turn be freely used for whatever purposes users see fit.
As far as the research group is concerned, the habits of communication thereby encouraged are illuminating in the varieties of primitivism they reveal. Within internet-based literature in Russian, for instance, we may observe a form of short prose that is ostentatiously dilettantish and whose self-conscious naivety – not least in making a joke of assigning contributions to such genres as aphorism, short fairy tale, haiku, or indeed cookie – masks a dissident attitude. The minima banalia of this pop culture, their receptiveness even to the simplest contribution, serves to renew a democratic promise: everybody gets to join in. Meanwhile, German-language book blogs bring together to exchange their personal reading experiences and to cultivate an animus against the expert judgements of critics and academics. Attitudes of resistance of a kind typical for minority bohemian and artistic subcultures in the twenty-first century now reappear as a conditioned reflex on the part of writing readers. Rather than taking minority position, such users hope to find a consensus surrounding their passions. This desire for social acceptance produces statements of a brevity calibrated to elicit quick responses from other readers in the web-based public sphere. Nothing could be less appropriate in such a situation than to express opinions ‘shared’ by nobody. This ‘affordance’ of short communicative forms is aggressively exploited via such messengers services as Telegram to spread news items which, though they may not be new to the recipient, are nonetheless gratefully received for confirming readers in their opinions, thereby obviating the need for further discussion.
Accordingly, in its discussion of the forms of factography, the research group will also have to address the fabrication of ‘alternative facts’ and their role in building cohesion in today’s tribalist “neo-communities” (Andreas Reckwitz, Michel Maffesoli). The purpose, however, must be not so much to deny that facts are artefacts as to enquire into conditions of possibility – both medial and material – of the various ways in which they end up being fetishized. A discussion of those economies of form that privilege varieties of formlessness over the diversity of content, seeking only to make the latter commercially marketable as ‘information’, must also consider the business models and profit calculations of the platform operators. Unlike publishers and traditional editorial media, web platforms are unencumbered by considerations of liability and copyright protection, and are able to profit accordingly.
The facts created in this manner have consequences for scholarly knowledge, generating the expectation of its easy accessibility – and the expense it entails. We can already observe how “data capitalism” (Michael Hegner), as practised by open access journals, drives up costs for authors looking for a share in the symbolic capital of prestigious publications, even for short articles.
History of the Theory of Small Forms
An interrogation of the epistemic and literary history of small forms must also include an examination of the theoretical history of its concepts of form. Objects of consideration may include both the small forms themselves as well as such forms in which these considerations – of large forms, too – occur. On the one hand, our discussions will seek to illuminate what historical concepts of form – as drawn from rhetoric, poetics, and literary theory – are to be assumed or updated in order to describe the formal character of the small forms under examination. On the other hand, in order to do justice to the peculiarity of small forms, we will have to explore what analytical vocabulary is provided by the authors and editors themselves. We will then continue our discussion of contemporary theoretical approaches that may help in developing appropriate concepts of form beyond the historical terminology of the field. The challenge here is to sharpen these concepts of form by clarifying their relation to concepts of genre and media, and by identifying the aspects in which they differ. Finally, we must investigate what kinds of valuation or stigmatization are associated with addressing a form as ‘small’, and what are their perceived advantages or deficits vis-à-vis ‘large’ forms. We are particularly interested in exploring how , in such contexts. the ‘small’ assumes a programmatic character within literary theory.
Rhetoric. Ancient Greek and Roman rhetoric theorizes small forms within the subfield of topoi and defines them as commonplaces for communicative reuse. Alongside the demands of inventio, the criteria of elocutio denominating stylistic virtues – e.g. brevitas, which has been much discussed by the research group – may also be found to apply here. Future explorations of this field will focus on the question of how small forms of prose and verse sharpen their profiles against one another in the Middle Ages and in the early modern age. At the same time, we have to explore how small verse and prose forms distinguish themselves from one another. It seems equally rewarding to discover historical scenes of debate where such small forms were criticized or the new legitimations and reform efforts derived from them were negotiated, leading to them outlasting the alleged end of rhetoric.
Poetics and Aesthetics. Drawing on the fundaments of rhetoric, it is primarily the poetics which arose in the sixteenth and seventeenth centuries in Italy, France, and England that work on the compilation of a catalogue of norms – now related to poetic genres in a narrower sense – in the interest of securing a scholarly knowledge of rules. That the regulatory effects of these textbooks on European literature was in fact limited, does not diminish the long-term effect that these poetics had on the discourse of judgment and taste regarding literature. Small forms are by no means omitted. But they are restricted to the verse genres – and are even given priority in them. Already for the concepts of art in antiquity, the elegy, satire, and epigram set the highest standards because their limited length requires true mastery. Small prose, in contrast, is not considered during these collaborations. In the ancient European orders of speaking and writing, its value nonetheless remains for so long undisputed as do the pragmatic functions and clearly defined sites of social deployment that are assigned to it by rhetoric.
That all changes when the validity of the art of speech and its rules and recipes for success erode and a discourse of aesthetics arises that, to be sure, reassess prose but does so primarily with reference to the novel. “Small prose is thereby excluded in manifold ways: it is neither great prose nor small lyric” (Thomas Althaus/ Wolfgang Bunzel/ Dirk Göttsche). Not only the emerging forms of small prose themselves but also the reflections on them and their formal character are therefore pushed into margins, thresholds, and interstices. This explains the importance that letters, prefaces, reviews, and so on gain for negotiations over the advantages and limitations of such forms. As paratexts, they serve as a platform for commenting upon other forms and genres. However, they also characterize themselves as products of a writing whose forms and styles can only be identified on an individual basis.
This is particularly evident in philosophical thought prose and in experimental short prose that come up with demanding and emphatically represented concepts of form. As difficult as it is to find a common denominator for these text types – aphorisms are listed as “Réflexions” (La Rochefoucauld) or “Pensées” (Pascal) and quoted in “Waste Books” [“Sudelbücher”] (Lichtenberg), feuilletons are titled “Walks” and “Soap Bubbles” (Walser) – all the more must their self-understanding be explained through their medium itself: as a reflection of the small form in praxis. Friedrich Schlegel’s fragments aim, in their particularity, to concurrently put on display the unavailability of the whole for which they strive. For Lukács, Bense, and Adorno, explorations of the essay as form necessarily have to take the form of the essay. Many feuilletons are about writing for the feuilleton, even if often for apologetic reasons: as a defense against the charge of banality. “In Notation (in my conception of it) there’s a condensation of Notare and Formare,” Roland Barthes remarks with regard to the small form of the note, which he held in high esteem (Preparation of the Novel).
The concepts of form developed and defended in the course of such discussions may be further elaborated by situating them within the history of theory. In doing so, the aim is above all to establish from what concepts of form – both traditional and currently preferred – they set themselves apart. But we must also enquire specifically into the paradigmatic role maintained by poetry in developing post-rhetorical concepts of form – a role that it may also be seen to acquire anew in author poetics.
Theory Programs of the 20th Century. Within recent theory programs, the regularity with which they turn to pre-modern small forms is striking. The structures of these small forms came more into focus as the literary theory of the 1960s brought linguistics and poetics closer together. In the wake of the linguistic turn, interest in the hermeneutics of individual creations shifted to typical narrative grammars that at the same time created a basis on which to expand the concept of literature and extend it to the formal repertoire of mass culture. Formalists and structuralists provided the impetus. They minutely dissected popular fairy tales, myths, and Biblical legends. Their results were then taken up by a comprehensive cultural semiotics onto which narrative macro-models have meanwhile latched.
However, André Jolles had already investigated “simple forms,” among them, fairy tales and myths. In 1930, he placed them at the center of a morphology that stood on firm anthropological ground. As we can frequently observe since the eighteenth century, literary theory intersects here with the history of other human sciences, which offers concepts for literary theory and in return is supplied by literary theory with hypotheses about “the” human being, its natural and cultural history. For this reason, it is worthwhile to take simple small forms seriously as the index fossils of a history of the science of literary study that explains which economies and theories of form develop here through the coevolution of folklore, ethnology, and anthropology. Attention should also be paid to revivals in the field of theory. André Jolles’s Simple Forms, for example, was first translated into English in 2017 and was published with a preface by Frederic Jameson, who emphasised parallels with formalist approaches in order to make the book serviceable to American debates over “new formalism”.
Finally, theoretical and programmatic reflections of small forms, extending from Nietzsche’s perspectivism – as the background to his aphorisms – and Musil’s essayism, to contemporary poetics of the small, are worthy of studies all their own. We might think here of the concept of “minor literature,” which still contains a high degree of political radiance. Borrowed from Kafka’s notebooks, Gilles Deleuze and Félix Guattari applied the term in the 1970s to all sorts of idioms that are “minor” insofar as they deviate from a hegemonic form and are afflicted with the stigma of being inferior. In more recent debates about globalization, the term has been applied to (national) literatures that do not enjoy an international market. In terms of the politics of theory, moreover, the concept has motivated a minoritarian type of publication that encourages the formulation of dissident positions: small books, separately published essays, individual lectures, and public interviews; volumes with a rhizomatic structure in which “a thousand plateaus” communicate with one another. We can identify in them a remediation of the essay as a form of theory that resists strict ideals of systematicity. They anticipate modes of writing in the age of digital networking through which certain online-forums concurrently make a name for themselves – including theory presses and journals with ambitious programs for reflecting on the present.