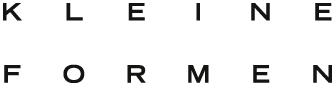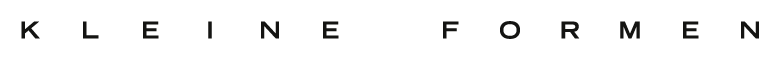Holy Rood in Hollywood. Apokryphe Erzählmuster der Vormoderne im Kanon des „großen Kinos“
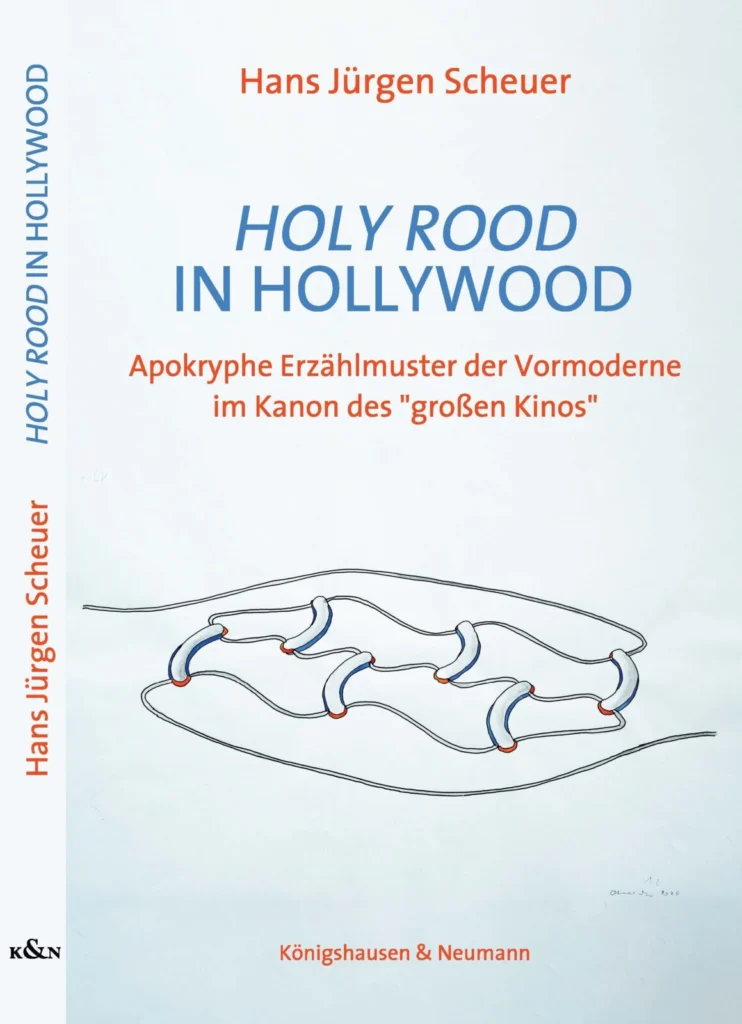
Hans Jürgen Scheuer: Holy Rood in Hollywood. Apokryphe Erzählmuster der Vormoderne im Kanon des „großen Kinos“
Fier basier, der gefährliche Kuss, als Kontaktstelle, an der im Artus- und Gralsroman Welt und Anderwelt einander momenthaft berühren; ein knappes Marien-Mirakel, in dem eine junge Nonne und die Gottesmutter in ihren entgegengesetzten Wirksphären miteinander die Positionen tauschen; das Motiv der Schatzfinder, die einander morden, weil sie den Sitz ihres wahren Schatzes verkennen; die Schösslinge vom Baum des Lebens, deren Auftauchen, Verschwinden und Wiederauftauchen die Legende vom Kreuzholz skandiert – alle genannten Punktgrößen exemplarischen Erzählens und Imaginierens der Begegnung von Leben und Tod, Immanenz und Transzendenz lassen sich vektoriell verschieben und ins Monumentale vergrößern: Im medialen Transfer vom seelisch bewegten inneren Bild, der imago agens vormoderner Wahrnehmungstheorie (Berns), zum technisch realisierten Bewegungsbild, dem kinema der modernen mechanischen Projektion, wächst das Minimalkalkül zur überdimensionierten silver screen auf, wird die kleinste Denkbewegung zur überwältigenden massenwirksamen Pathosgeste gesteigert. So begegnen wir bei Hitchcock und Shyamalan der Kommunikation zwischen Lebenden und Toten aus der matière de Bretagne wieder, in Vollmoellers und Langs Stummfilmen sowie im Blade Runner-Komplex dem Mirakelkonzept eines Caesarius von Heisterbach aus dem 13. Jahrhunderts, in Filmen von Huston, Tarantino und den Coen-Brüdern bis zu Ridley Scott und Denis Villeneuve den Ablegern des größten Narrativs der christlichen Tradition: der Kreuzholzlegende. ‚Holy Rood in Hollywood‘ entfaltet daraus ein ungeahntes Netzwerk innerweltlicher Transzendenzsimulationen in Kino und Dichtung und entwickelt, ausgehend von Autoren wie Robert Musil, Vladimir Nabokov und Philipp K. Dick, eine neuartige Theorie der „apokryphen Relation“ über die Aktualisierbarkeit religiöser Wahrheitsansprüche im Zuge des Medientransfers und seiner technischen Formatwechsel.
So drehen sich nach und nach die Körper der Lebenden in Shyamalans ‚The Sixth Sense‘, um ihre verdeckte Gestalt im Tod zu zeigen, und schraubt sich Hitchcocks ‚Vertigo‘ um die vierfach wiederholte Szene eines Kusses aus dem Reich der Toten zum freischwebenden, im Sturz arretierten Wirbel auf; so bildet die Wundererzählung ‚De Beatrice custode‘ des Caesarius von Heisterbach die grundstürzende Figur einer Kinotradition, die von Karl Vollmoellers ‚The Miracle‘ (1912) und Fritz Langs ‚Metropolis‘ (1927) bis zum ‚Blade Runner‘-Komplex (Ridley Scott, Denis Villeneuve) reicht; so prägen Geoffrey Chaucer und Hans Sachs einen mittelalterlichen Erzähltyp aus, der in Filmen von John Huston und Alfred Hitchcock ebenso weiterarbeitet wie in den Plotkonstruktionen und Bildinventionen Quentin Tarantinos oder der Gebrüder Coen, überlagert von den Extensionen der Legend of the Holy Rood, die in ‚Blade Runner 2049‘ (2017) mit all ihren messianischen Implikationen wiederersteht.
In überraschend vielen Fällen lassen sich die Blockbuster Hollywoods auf Exempelkerne und kleine Formen der Spätantike, des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zurückführen, ohne dass sie als „Mittelalterfilme“ auftreten. Dabei erschließt sich einerseits in der „Bestimmbarkeit des Jetzt“ (Benjamin), was in den alten Mustern angelegt, aber latent geblieben ist, und andererseits – in umgekehrter Blickrichtung –, welche religiösen Denkmuster in modernen Versionen, ihren Inversionen und Perversionen, unmerklich und entstellt insistieren. Aus jenen Befunden entsteht ein nicht-teleologisches, diachron und antichronologisch sich entfaltendes Beziehungsnetz zwischen Stoffen, Motiven, Figuren und widerstreitenden Bildontologien (Descola). Vermittelt über Autoren wie Robert Musil, Vladimir Nabokov und Philipp K. Dick, wird es in eine neuartige Theorie überführt: Durch eine Revision des Dualismus von Kanon und Apokryphon zeichnet sich eine Poetik der „apokryphen Relation“ ab. Sie macht die Doppelbewegung von Kanonisierung und Apokryphisierung, die üblicherweise als Abspaltung der wahren von der minderen, gefälschten oder parasitären Tradition gedacht wird, als unauflöslich verwickelten Koprozess verständlich – unverzichtbar für das Codieren, Weitergeben und Sichern von Wahrheitsansprüchen durch fortwährende Umschriften und Formatwechsel.
ISBN: 978-3-8260-9191-9
Link zum Buch: https://verlag.koenigshausen-neumann.de/product/9783826091919-holy-rood-in-hollywood/